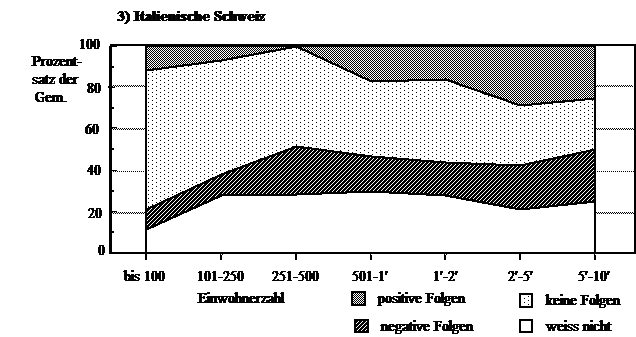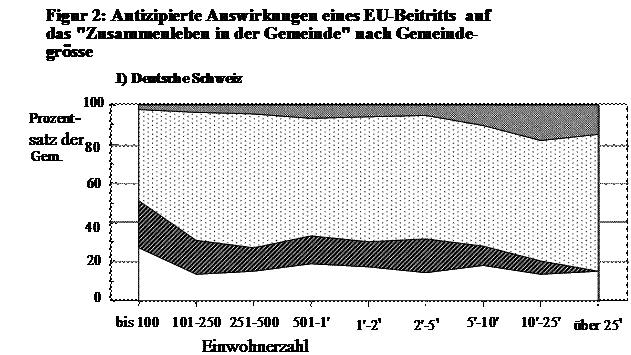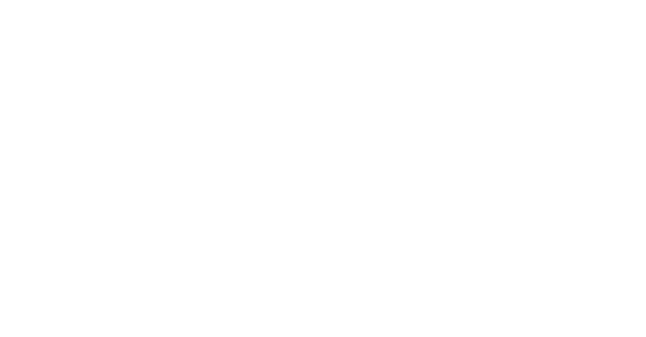|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Antizipierte Auswirkungen eines Beitritts der Schweiz zur EU auf die Schweizer Gemeinden Ein Beitrag im Rahmen des Nationalfondsprojektes: "Aktuelle Wandlungstendenzen und Leistungsgrenzen der Gemeindeorganisation in der Schweiz" Dezember 1996
Zusammenfassung Die Chefbeamten (Schreiber) der Schweizer Germeinden unterscheiden sich stark darin, welche Auswirkungen eines möglichen Schweizer Eu-Beitritts auf ihre Gemeinde sie antizipieren. Angesichts der bekannten demoskopischen Befunde und Abstimungsergebnisse überrascht nicht, dass im deutschen Sprachraum die negativsten und in der französischen Schweiz die positivsten Meinungen bestehen, während das Tessin eine - generell eher der Deutschschweiz ähnelnde - Mitttelstellung einnimmt. Die Divergenzen zwischen der deutschen Schweiz und der Romandie werden aber dadurch relativiert, dass sie am stärksten bei den kleineren (besonders den ausserhalb der Agglomerationsgürtel liegenden) Gemeinden in Erscheinung treten, während die Städte (und in teilweise auch die suburbanen Kommunen) beider Sprachregionen zumindest in der Beurteilung wirtschaftlicher Auswirkungen relativ stark konvergieren. Im Vergleich zur Sprachregion, Bevölkerungsgrösse und geographischen Lage bleibt die kausale Bedeutung anderer Faktoren gering und auf einzelne Aspekte begrenzt. Im besonderen gibt es keine Hinweise dafür, dass Gemeinden mit gut ausgebildeter und wohlhabender Bevölkerung und/oder mit moderner Wirtschaftsstruktur der Frage einer europäischen Integration der Schweiz offener gegenüberstünden.
Inhalt 1. Methodische
Hinweise
1. Methodische Hinweise Die vorliegende Studie basiert auf einer im Jahre 1994 am Soziologischen Institut der Universität Zürich durchgeführten schriftlichen Befragung. Finanziert wurde sie vom Schweizerischen Nationalfonds. Die Untersuchung richtete sich an die Gemeindeschreiberinnen und Gemeindeschreiber sämtlicher 3'017 Schweizer Gemeinden (Stand 1. Jan. 1994). Insgesamt haben 2'079 Gemeinden an der Befragung teilgenommen und die Beteiligung ist mit einem Rücklauf von knapp 70 Prozent ausgesprochen hoch ausgefallen. Die für die vorliegenden Arbeiten verwendeten Daten stammen nicht nur aus der Befragung von 1994. Als Ergänzung sind noch andere Zahlen in die Analyse einbezogen worden, so jene des Soziologen Rolf Nef, der für seine Analysen über kommunales Wahlverhalten Datensätze demographischer, ökologischer und sozioökonomischer Art für sämtliche Gemeinden der Schweiz zusammengetragen hat. Dabei handelt es sich vor allem um Volkszählungsdaten, Betriebszählungsdaten und Wehrsteuerstatistiken. Ausserdem konnten wir auch auf Daten eines eigenen Forschungsprojektes zurückgreifen, die 1988 durch eine erste Befragung der Gemeindeschreiber und Gemeindeschreiberinnen sämtlicher Gemeinden der Schweiz erhoben wurden. Diese Befragung erzielte einen Rücklauf von über 80 Prozent, so dass sie uns für die Analyse des Wandels der politisch-administrativen und der kommunalpolitischen Organisation der Gemeinden im allgemeinen und des kommunalen Parteiwesens im besonderen sehr aussagekräftige Resultate lieferte. 2. Einleitung
Die binnengesellschaftlichen
Auswirkungen eines EU-Beitritts sind im Falle der Schweiz vor allem deshalb
besonders komplex und schwer voraussehbar, weil die drei Ebenen unseres
föderalistischen Staatsaufbaus (Bund, Kanton und Gemeinden) Selbstverständlich wäre die Bundesebene am direktesten und tiefgreifendsten davon berührt: vor allem auch deshalb, weil die supranationalen Jurisdiktionen der EU - auch beim Vollzug der Maastrichter Verträge - schwerpunktmässig immer noch stark in den dem Bund vorbehaltenen Kompetenzbereichen (Wirtschaftspolitik, Aussenpolitik u.a.) liegen. Bereits die Kantone sind vorerst nur in relativ wenigen Bereichen ihrer angestammten Vollzugskompetenzen betroffen: z.B. im Bereich der beruflichen und universitären Ausbildung oder der internationalen polizeilichen Kooperation ("Schengener Abkommen"): zwei Bereiche, die mit den Maastrichter Verträgen stärker in den Vordergrund rücken werden. Auf der Gemeindeebene sind die Auswirkungen einerseits noch enger begrenzt, andererseits aber noch weniger voraussehbar, weil eher indirekte Betroffenheiten vorherrschen, die je nach den inneren Merkmalen einer Gemeinde (z.B. ihrer Wirtschafts- oder Bevölkerungsstruktur) sowie ihrem Verhältnis zur kantonalen Ebene sehr unterschiedlich sind. Auf demographischer Ebene beispielsweise kann die im EU-Raum geltende Freizügigkeit zur Folge haben, dass gewisse Gemeinden einen Zuwachs an ausländischer Wohnbevölkerung erhalten, der sich wiederum auf das soziale Zusammenleben in der Gemeinde auswirken kann. Überdies werden auch die kommunalpolitischen Verhältnisse berührt, insofern die Maastrichter Verträge verlangen, dass der ausländischen Wohnbevölkerung das aktive Wahlrecht auf Gemeindeebene zugestanden wird. Im ökonomischen Bereich sind selbstverständlich vielerlei Auswirkungen denkbar, wie sie aus der veränderten Konkurrenzfähigkeit ortsansässiger Betriebe im EU-Binnenmarkt oder aus dem Abbau staatlicher Subventionszahlungen (z.B. in der Landwirtschaft) resultieren. Auf dem politisch-administrativen Niveau schliesslich ist von Bedeutung, dass die Gemeinden im Rahmen des Vollzugs europarechtlicher Bestimmungen noch stärker als bisher in vertikale Verflechtungszusammenhänge mit Bund und Kantonen eingebunden werden, und dass sie bei der Vergabe öffentlicher Submissionsaufträge bestimmten Einschränkungen (z.B. einer Europaweiten Ausschreibepflicht) unterliegen. Andererseits könnten sich den Gemeinden auch gewisse zusätzliche Autonomiespielräume eröffnen: z.B. insofern es ihnen gelingt, einen direkten Zugang zu EU-Subventionen (z.B. für die Regionalförderung) zu gewinnen. Generell sind vor allem Voraussagen über längerfristige Auswirkungen mit prinzipieller Unsicherheit behaftet,
Ungeachtet dieser Erschwernisse kommt der Frage, welche Auswirkungen eines EU-Beitritts die Gemeinden antizipieren, eine eigenständige Bedeutung zu: weil derartige Antizipationen unabhängig davon, wie real oder irreal sie sind, im politischen Kräftefeld unseres föderalen Staates ihre Wirksamkeit entfalten. So könnten weit verbreitete negative Antizipationen den Bundesrat an der Verfolgung seiner erklärten EU-Annäherungspoltik behindern, insofern die Gemeinden die Kantone dazu nötigen könnten, auf Bundesebene Vorbehalte oder gar Widerspruch gegen eine solche Politik geltend zu machen. Natürlich hängt dies vor allem davon ab, ob es eher die politisch dominierenden Städte oder die - weniger einflussreichen - ländlichen Kleingemeinden sind, die der Annäherung an "Europa" besonders negativ gegenüberstehen. Es darf davon ausgegangen werden, dass kaum jemand in der Schweiz daran denkt, eine allfällige Integration in die Europäische Union mit einem grundlegenden Wandel des binnenstaatlichen Föderalismus oder einer - auch nur bescheidenen - kommunalen Gebietsreform zu verknüpfen. Tatsächlich impliziert der Beitritt zur EU zwar gewisse Kompetenzverlagerungen (insbesondere vom Parlament zur Exekutive), nicht aber einen gerichteten Umbau der hergebrachten föderalistischen Struktur (Müller 1992). Umso dringender stellt sich die Frage, wie die politische Willensbildung in der Europafrage durch den aus dem 19. Jh. stammenden Status quo des Schweizerischen Gemeindeföderalismus beeinflusst wird, der nach allgemeiner (wenn auch selten bewusst reflektierter) Auffassung unverändert ins 21. Jahrhundert hinübergerettet werden soll. Die nachfolgenden empirischen Ergebnisse stützen sich auf die an den Gemeindeschreiber gestellte Frage, ob ein Schweizer EU-Beitritt seiner Meinung nach
vorteilhaft, unvorteilhaft oder überhaupt nicht beeinflussen würde. Natürlich kommt in einer solchen Meinungsäusserung kein "offizieller" Standpunkt zum Ausdruck, der im Rahmen öffentlicher Diskussion erarbeitet und durch einen Behördeentscheid zur verbindlichen Position der "Gemeinde" erhoben worden wäre. Immerhin kann davon ausgegangen werden, dass die Schreiber (zusammen mit den Gemeindepräsidenten und evtl. einigen anderen Amtsträgern) zu jenen Personen gehören, die dank ihrer langjährigen Vertrautheit mit der Gemeinde einerseits, und ihrer zentralen Position in den kommunalen Kommunikationsnetzwerken und Entscheidungsprozessen andererseits, besonders dazu disponiert sind, eine besonders gut informierte und dank breiter Abstützung relativ repräsentative Meinung zum Ausdruck zu bringen. Überdies mögen sie - aus denselben Gründen - innerhalb ihrer Gemeinde häufig die Rolle von "opinion leaders" spielen, die nicht nur auf die behördlichen Beratungs- und Entscheidungsprozesse, sondern auch auf die Meinungsbildung in informellen Kreisen (z. B. an Wirtshaustischen) und in der kommunalen Öffentlichkeit einen gewissen Einfluss haben. Generell hängt die Relevanz der erhaltenen Antworten natürlich nicht in erster Linie davon ab, ob sie auf eine gut informierten, realistischen Situationsbeurteilung beruhen und sich im hypothetischen Fall eines EU-Beitritts objektiv bewahrheiten würden. Vielmehr liegt ihre Bedeutung darin, dass sie subjektiv geglaubt werden und dadurch ihre Wirkungen auf die öffentliche Meinungsbildung (und evtl. auch auf das politische Entscheidungshandeln) entfalten.
Wie die öffentlichen Diskussionen um den EWR-Vertrag und um die nachfolgenden bilateralen Verhandlungen gezeigt haben, wird die Freiheit des Personenverkehrs in der Schweiz als eine der schwerwiegendsten und bedrohlichsten Auswirkungen empfunden, die mit einer Annäherung an die EU verbunden sind. Dahinter stehen Befürchtungen, dass durch den - objektiv in seinem Ausmass schwer abschätzbaren - Zustrom von EU-Bürgern die Bevölkerungsstruktur unseres Landes in unkontrollierbarer Weise verändert würde: mit vielfältigen Konsequenzen, die von der multikulturellen Zusammensetzung von Schulklassen über zunehmende Verständigungsschwierigkeiten in der dörflichen Nachbarschaft bis zum Anwachsen des Kriminaltourismus reichen könnten. In gewissen Fremdenverkehrsorten kommt die Befürchtung hinzu, dass ein liberalisierter Grundstückmarkt die Bodenpreise und Mieten hochtreiben und den Aufenthalt für Einheimische dadurch unerschwinglich machen könnte (vgl. Hug 1992). Andererseits entsteht auch die Perspektive, dass sich die ausländische Wohnbevölkerung anteilsmässig stärker als heute aus Immigranten aus befreundeten Nachbarländern rekrutieren könnte, weil die Kontingente aus Nicht-EU-Staaten (Ex-Jugoslawien, Türkei etc.) restriktiver als jetzt gehandhabt werden. Wer immer "positive" oder "negative" Auswirkungen antizipiert, äusserst deshalb ein sehr komplexes Gesamturteil, in dem sich kognitive Elemente (=Prognose von Entwicklungen) und evaluativen Komponenten (=Bewertung dieser Entwicklungen) miteinander verbinden. In allen drei Sprachregionen sind über die Hälfte aller Befragten der Ansicht, die Bevölkerungsstruktur ihrer Gemeinde würde durch einen EU-Beitritt weder in negativer noch in positiver Weise berührt (Tabelle 1). Im übrigen zeigt sich, dass im deutschen Sprachraum negative und in der französischen Region positive Beurteilungen überwiegen, während sich im Tessin beide ungefähr die Waage halten. Ungewissheiten über die Richtung solcher Auswirkungen sind offensichtlich in der Westschweiz am meisten und im deutschsprachigen Raum am wenigsten verbreitet. Ob darin ein höheres politisches Informiertheitsniveau der Deutschschweizer Beamten zum Ausdruck kommt, erscheint keineswegs gesichert: denn angesichts der objektiv bestehenden Ungewissheiten (vgl. oben) könnte es sein, dass gerade politisch gut informierte Schreiber ehrlicherweise zum Schluss kommen, über demographische Konsequenzen einer EU-Mitgliedschaft nichts Sicheres zu wissen. Tabelle 1:
Antizipierte Auswirkungen
eines EU-Beitritts auf die "Bevölkerungsstruktur" der Gemeinde
Bei einer Aufgliederung nach Grössenklassen zeigt sich in den drei Sprachregionen ein unerwartet disparates, ja widersprüchliches Bild (Figur 1). In der deutschen Schweiz neigen die Schreiber kleinerer, mittlerer und grösserer Gemeinden in gleicher Weise dazu, einem EU-Beitritt entweder überhaupt keine Bedeutung für die kommunale Bevölkerungsstruktur beizumessen, oder aber eher negative als positive Auswirkungen zu prognostizieren. Allerdings fällt auf, dass im Skalenbereich zwischen 2'000 und 25 000 Einwohner die Prozentanteile negativer Antworten sinkt und diejenige positiver Reaktionen etwas steigt. Diese letztgenannte Tendenz nun ist im französischen Sprachraum sehr viel ausgeprägter. Hier bleiben negative Antizipationen völlig auf sehr kleine Gemeinden (mit weniger als 1'000 Einwohnern beschränkt, während die positiven Einstellungen mit wachsender Einwohnerzahl häufiger werden und in den Städten (mit mehr ca. 50%!) völlig überwiegen. Genau umgekehrt ist es im Tessin, wo negative Antizipationen bei den Kleinstgemeinden kaum vorkommen und mit wachsender Bevölkerungszahl ständig an Bedeutung gewinnen. Bei der Interpretation dieser divergenten Ergebnisse ist zu beachten, dass die Schreiber grösserer Gemeinden in beiden romanischer Regionen überwiegend glauben, dass mit einem EU-Beitritt demographische Wirkungen verbunden seien. Dies entspricht der Hypothese, dass der freie Personenverkehr vor allem in den grösseren, urbanen Gemeinden zu einem verstärkten Influx von Ausländern führen könnte, weil sie häufiger als rurale Kleingemeinden über international attraktive Arbeitsplätze verfügen. Wenn man zusätzlich annimmt, dass viele dieser (erwarteten) Einwanderer möglicherweise aus dem gleichsprachigen benachbarten Ausland stammen, könnten die gegenläufigen Ergebnisse ihren Grund darin haben, dass die Westschweizer dem zu erwartenden Zustrom von Franzosen mit mehr Sympathie als die Tessiner dem voraussehbaren Ansturm von Italienern gegenüberstehen (vgl. Allenbach/Aschinger 1992). Nicht auszuschliessen ist aber auch die alternative Hypothese, dass in diesem Ergebnis eine relativ generalisierte Ausländerfreundlichkeit der Westscheizer zum Ausdruck kommt, die sowohl mit der zurückhaltenderen Mentalität in der deutschen wie auch in der italienischen Schweiz erheblich kontrastiert. In der deutschen Schweiz wird die Häufigkeit negativer Antizipationen nicht in erster Linie durch die Bevölkerungsgrösse, sondern durch das demographische Umfeld der Gemeinde bestimmt. So sind die Schreiber stadtferner Dörfer (z.B. in Bergregionen) sehr viel häufiger als diejenigen grosstadtnaher Agglomerationsgemeinden geneigt, negative Auswirkungen zu sehen (Tab. 2).
Komplexere multivariate Analysen
zeigen deutlich, dass ausschliesslich diese "urbane Distanz" (bzw. "Proximität")
relevant ist, während andere damit verknüpfte Faktoren (bäuerliche
oder touristische Erwerbsstruktur, niedriges Niveau an Bildung oder Einkommen
usw.) keinerlei Bedeutung haben. Dieses Ergebnis könnte
darauf hinweisen, dass die Offenheit (und Angstfreiheit) gegenüber
fremden Zuwanderern in der deutschen Schweiz stärker als beispielsweise
in der Westschweiz eine auf urbane und suburbane Zonen beschränkte
Mentalitätseigenschaft darstellt, die mit einer ausgeprägten
Skepsis und Ängstlichkeit ausserhalb städtischer Ballungsgürtel
kontrastiert.
Reisezeit zur nächsten
Grosstadt (100'000 oder mehr Einwohner) mit öffentlichen Verkehrsmitteln
(Gem. zwischen 250-5000 Einwohnern)

4. Auswirkungen auf das Zusammenleben in der Gemeinde Mit den Konsequenzen für das "Zusammenleben in der Gemeinde" ist eine besonders hypothetische Auswirkung des EU-Beitritts angesprochen, der nicht nur von den durch Zuwanderungen bedingten Veränderungen der Bevölkerungsstruktur abhängig ist, sondern auch davon, wie diese Zuwanderer sich verhalten und auf welche Weise die autochthone Schweizer Bevölkerung mit ihnen interagiert. Da die Maastrichter Verträge bekanntlich verlangen, dass den Ausländern innerhalb ihres Wohnorts kommunale Mitwirkungsrechte gewährt werden, erhält das "Zusammenleben in der Gemeinde" unweigerlich auch eine politische Dimension, die im Lichte der direkt-demokratischen Institutionen auf kommunaler Ebene eine besondere Bedeutung gewinnt. Erwägungen in diese Richtung mögen in der deutschen Schweiz relevanter sein als in manchen Kantonen der Westschweiz, wo die kommunale Autonomie weniger ausgeprägt ist und wo anstelle der Einwohnerversammlung repäsentative Gremien ("conseil municipal") bestehen. Tabelle 3:
Antizipierte Auswirkungen
eines EU-Beitritts auf das "Zusammenleben in der Gemeinde"
Die Ergebnisse zeigen, dass noch grössere Prozentanteile aller Befragten als im Falle der "Bevölkerungsstruktur" der Meinung sind, dass mit einem EU-Beitritt keinerlei Auswirkungen auf das soziale Gemeindeleben verbunden seien (Tab. 3). Erwartungsgemäss dominieren in der deutschen Schweiz negative und in der französischen Schweiz positive Antizipationen, während das Tessin sich - genau wie im Abstimmungsergebnis zum EWR-Vertrag - eher der deutschen Schweiz annähert. Generell wäre zu vermuten, dass Befürchtungen in dieser Hinsicht vorwiegend in kleinen und ländlichen Gemeinden mit homogen-inländischer Bevölkerung verbreitet sind, weil diese ein besonders hohes Mass an sozialer Kohäsion und "Gemeinschaftlichkeit" zu verlieren haben und ausländische Zuzüger infolgedessen am ehesten als "fremd" und unassimilierbar empfunden werden. In Übereinstimmung mit dieser Vermutung zeigt sich in der deutschen (und schwächer ausgeprägt auch in der Romandie), dass der Anteil negativer Antizipationen mit zunehmender Gemeindegrösse sinkt. Im übrigen ähneln die Ergebnisse sehr denjenigen über die Auswirkungen auf die "Bevölkerungsstruktur": indem mit zunehmender Gemeindegrösse in der Westschweiz eine positive, in der Südschweiz eine negativere Einstellung in den Vordergrund rückt, während die Rate der "Nichtwisser" eher sinkt. Daraus ist zu schliessen, dass es in beiden Regionen die Auswirkungen des demographischen Strukturwandels auf das "kommunale Zusammenleben" sind, die den gegenläufigen Beurteilungen zugrundeliegen.
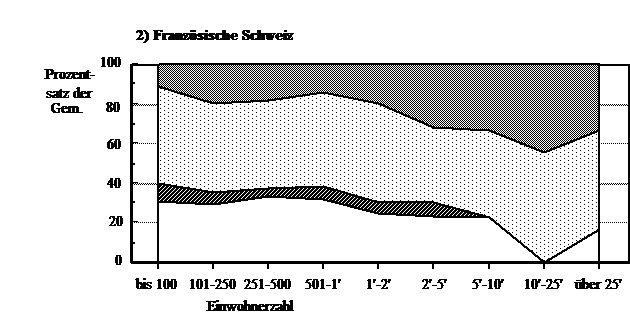
Die Tessiner Ergebnisse sind
theoretisch nicht leicht zu verstehen, weil schwer einsehbar ist, warum
ausgerechnet in grösseren Gemeinden, in denen ohnehin ein anonymer
Umgang vorherrscht, das "Zusammenleben" durch einen hypothetischen Zustrom
ausländischer Immigranten negativ beeinflusst werden könnte. Wiederum wird die Häufigkeit
negativer Antizipationen in der deutschen Schweiz (und teilweise auch in
der Westschweiz) relativ stark durch den geographischen Standort der Gemeinde
bestimmt. So sehen selbst die Schreiber
sehr kleiner Gemeinden erheblich häufiger negative Auswirkungen voraus,
wenn sich ihre Kommune ausserhalb des Ballungsgürtels einer Grosstadt
befindet (Tab. 4). Oder umgekehrt formuliert: Agglomerationsgemeinden zeigen
ein ähnlich positives Einstellungsmuster wie die Städte, in deren
Nähe sie sich befinden. Dies ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass
sie nicht nur ihre demographische Situation, sondern auch ihr gemeindeinternes
Sozialklima von der überlokalen Ebene des gesamten urbanen Siedlungsraums
her beeinflusst sehen.
Reisezeit zur nächsten
Grosstadt (100'000 oder mehr Einwohner) mit öffentlichen Verkehrsmitteln
(Gem. zwischen 250-5'000 Einwohnern)
Schliesslich stellt man fest,
dass Gemeinden mit einem geringen Anteil von Ausländern an ihrer Wohnbevölkerung
häufiger negative Auswirkungen auf das soziale Gemeindeleben perzipieren
(Tab. 5). Es sind dies die Dörfer,
in denen sich die einheimische Bevölkerung bisher weitgehend "unter
sich" fühlen und eine dementsprechend hohe Kohäsion und kulturelle
Homogenität aufrechterhalten konnte. Sie verbinden mit dem freien
Personenverkehr logischerweise mehr Befürchtungen als bereits "ausländergewohnte"
Gemeinden, die eher davon ausgehen können, dass der Zuzug von EU-Bürgern
bloss eine qualitative Veränderung ihrer ausländischen Bevölkerungssegmente
(hinsichtlich der Zusammensetzung nach Herkunftsstaaten) bewirkt.
Tabelle 5: Antizipierte Vor- und Nachteile eines EU-Beitritts für das "Zusammmenleben in der Gemeinde": nach Anteil der Ausländer an der Gemeindebevölkerung Anteil der ausländischen
Wohnbevölkerung:
Wenn selbst die makroökonomischen Auswirkungen eines EU-Beitritts auf die nationale Volkswirtschaft der Schweiz sehr strittig sind, so stösst die Frage nach den lokaleren Konsequenzen für einzelne kommunale und regionale Wirtschaftsräume auf noch grössere Schwierigkeiten, weil vielfältige binnenstaatliche Mitbeeinflussungsfaktoren (z.B. Standortänderungen von Firmen oder Erwerbstätigen) berücksichtigt werden müssten, die sich kaum objektiv voraussehen lassen. Im besonderen wird der von einer Gemeinde erfahrene wirtschaftliche Wandel nicht bloss durch das Schicksal ihrer eigenen lokalen Gewerbe-, Industrie- und Dienstleistungsbetriebe bestimmt, sondern auch durch die Entwicklungen im gesamten Umfeld, das ihren Einwohnern für die Erwerbstätigkeit zur Verfügung steht oder aus dem die Kommune auf anderen Wegen (z.B. über den kantonalen Finanzausgleich) finanzielle Einkommensbeiträge bezieht. Wiederum trauen sich nahezu 80% der Gemeindeschreiber eine Prognose zu; und erneut liegt die Quote der "Weiss-Nicht"-Antworten in der deutschen Schweiz niedriger als in den übrigen beiden Regionen (Tab. 6). Tabelle 6:
Antizipierte Auswirkungen
eines EU-Beitritts auf die wirtschaftliche Situation der Gemeinde.
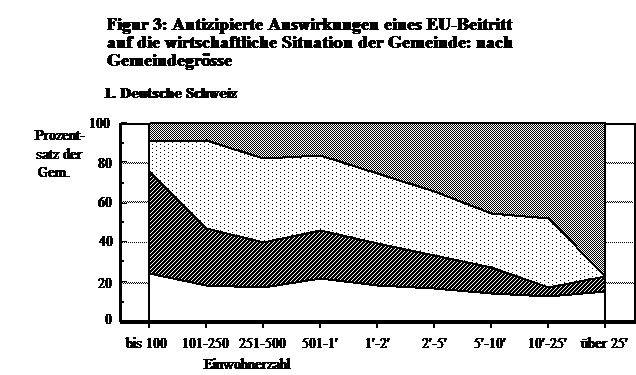
Im Vergleich zu den demographischen Beurteilungen (vgl. Tab. 1) fällt auf, dass die Schreiber der deutsch- und französischsprachigen Gemeinden ungefähr gleich häufig nachteilige, sehr viel häufiger aber vorteilhafte Auswirkungen antizipieren, und erheblich weniger der Meinung sind, dass keinerlei ökonomische Konsequenzen zu erwarten seien. Während sich positive und negative Antizipationen in der Deutschschweiz ungefähr die Waage halten, dominieren die optimistischen Gemeinden hingegen in der Westschweiz im Verhältnis 5:1. Gegenüber beiden grösseren Landesteilen profiliert sich das Tessin dadurch, dass fast die Hälfte aller Informanten keine wirtschaftlichen Auswirkungen sehen und die übrigen zum grösseren Teil eine pessimistische Einstellung vertreten. Auch bei einer Aufgliederung nach Grössenklassen zeigt sich, dass im deutschen und französischen Sprachraum ziemlich ähnliche Beurteilungsverhältnisse bestehen Figur 3). In beiden Regionen steigt die Häufigkeit optimistischer Sichtweisen mit zunehmender Bevölkerungsgrösse sehr stark an: so dass sich insbesondere die Städte kaum voneinander unterscheiden. Die ausgeprägtesten interregionalen Divergenzen bestehen bei den Kleinstgemeinden, wo im deutschen Sprachraum pessimistische Beurteilungen überwiegen, während in der Westschweiz meist überhaupt keine Auswirkungen wahrgenommen werden. Auch im Tessin nehmen positive Antizipationen in grösseren Gemeinden eher zu. Anders als in den übrigen Sprachregionen wachsen - ähnlich wie hinsichtlich der demographischen Auswirkungen - aber auch die pessimistischen Beurteilungen an: so dass sich in der Grössenklassse zwischen 2'000 und 10'000 Einwohner zwei einstellungsmässig stark polarisierte Gemeindegruppen gegenüberstehen. In allen drei Regionen sind die Schreiber grösserer Gemeinden nur selten der Ansicht, dass die lokale Wirtschaft von einem EU-Beitritt unberührt bleiben würde.
Die Vermutung liegt nahe, dass
selbst kleine Gemeinden mit einem EU-Beitritt optimistische Wirtschaftserwartungen
verbinden, wenn sie sich in einem städtischen Agglomerationsgürtel
befinden und deshalb die Möglichkeit haben, von den ökonomischen
Vorteilen einer grösseren Stadt zu profitieren. Diese naheliegende Hypothese
wird nun aber nur insoweit empirisch bestätigt, als die Häufigkeit
pessimistischer Antworten mit zunehmender Nähe zu einer Grosstadt
sinkt (Tab. 7). Wider Erwarten zeigt sich,
dass in der deutschen Schweiz die Frequenz positiver Antizipationen mit
wachsender urbaner Distanz gleichbleibt und in der Westschweiz sogar erheblich
steigt. So sind es in erster Linie
die Divergenzen im Bereich ruraler Kleingemeinden in Land- und Bergregionen,
die für den bekannten "Röschtigraben" in der Europafrage verantwortlich
sind. Tabelle 7: Antizipierte Vor- und Nachteile eines EU-Beitritts für die wirtschaftliche Situation der Gemeinde: nach Reisedistanz der Gemeinde zur nächsten Grossstadt Reisezeit zur nächsten
Grosstadt (100'000 oder mehr Einwohner) mit öffentlichen Verkehrsmitteln
(Gem. zwischen 250-5'000 Einwohnern)
Demgegenüber stehen bei den vollbeschäftigten Gemeinden möglicherweise eher die Risiken als die Chancen eines Beitritts im Vordergund: weil sie den Status quo vorteilhaft finden und denken, dass sie bei jedem Wandel wenig gewinnen, aber viel zu verlieren hätten. Tatsächlich gilt für alle drei Regionen, dass die Schreiber stark rezessionsgeschädigter Kommunen häufiger positive ökonomische Konsequenzen prognostizieren. Am ausgeprägtesten gilt diese Regularität für das Tessin, wo umgekehrt auch die Häufigkeit pessimistischer Antizipationen in der vorausgesagten Weise mit der aktuellen kommunalen Wirtschaftslage korreliert. So ist die positivere Europastimmung in der Westschweiz wenigstens zu einem kleinen Teil dadurch zu erklären, dass dort doppelt so viele Gemeinden als in den übrigen beiden Sprachregionen (d.h. 32% gegenüber 15% in der Deutschschweiz und 16% im Tessin) angeben, stark unter Arbeitslosigkeit zu leiden. 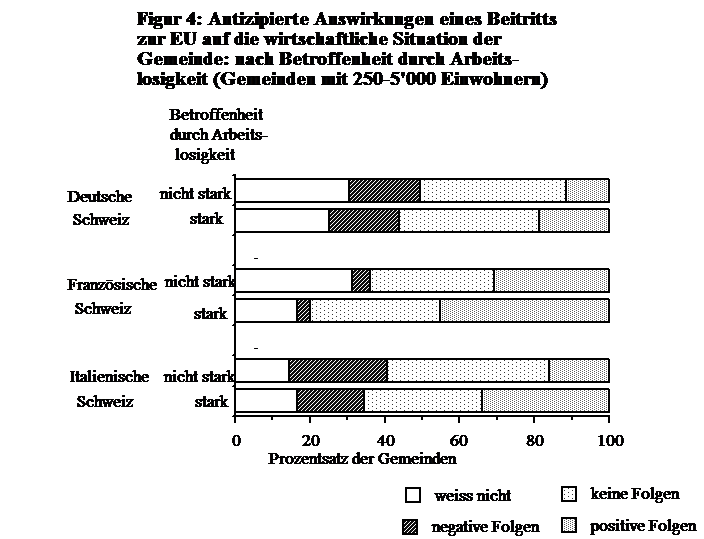
6. Auswirkungen auf den politischen Handlungsspielraum der Gemeinde Auch den Integrationsbefürwortern ist klar, dass sich die EU bis dato an zentralistischen Prinzipien der politischen Entscheidungsfindung und des administrativen Vollzuges orientiert, die mit der direkten Demokratie und dem föderalistischen Staatsaufbau der Schweiz gleichermassen in einem Spannungsverhältnis stehen. So werden beispielsweise bei der Umsetzung von Richtlinien in staatliche Gesetzgebungen sehr kurze Fristen gesetzt, die in einem mehrstufigen Staatswesen mit seinen komplizierten und langwierigen Diskussionsverfahren und Entscheidungswegen kaum eingehalten werden können (vgl. Jagmetti 1991; Lareida 1991), und bei der Implementierung der Gesetze und Verordnungen wird davon ausgegangen, dass der Zentralstaat mit seinen Kontrollorganen für eine durchwegs homogene Vollzugspraxis sorgt (Thürer 1991b). Nur in relativ wenigen Bereichen allerdings (z.B. bei den Vergaberegeln von Submissionsaufträgen) würde ein Beitritt zur heutigen EU ganz direkt angestammte Automomierechte der Schweizer Gemeinden tangieren. Aber angesichts des rasch expandierenden Europarechts und der konsequent integrationsfreundlichen Rechtssprechung des Europäischen Gerichtshofs (vgl. Thürer 1991a; Schindler 1992: 211) ist die Annahme realistisch, dass die Kommunen in Zukunft noch weitergehende Einschränkungen ihrer politischen Handlungsspielräume in Kauf zu nehmen hätten. Gegen diese einseitige Sichtweise können allerdings zwei Einwände gemacht werden:
Konkret zeigt sich dies darin, dass die Maastrichter Verträge der Diskussion um das "Subsidiaritätsprinzip" neuen Auftrieb gegeben haben (vgl. Kux 1992; Bruha 1994), dass der neugegründete "Kongress der Gemeinden und Regionen Europas" für eine Dauerrepräsentation kommunaler Interessen innerhalb der EU sorgen wird, dass mit Jacques Santer ein Anwalt kleinräumiger politischer Gebilde den Kommissionsvorsitz übernommen hat, und dass die Regionalentwicklungspolitik der EU manchen subnationalen Akteuren die Perspektive eröffnet, sich unabhängig von seinem Nationalstaat Subventionsmittel zu verschaffen (Schindler 1992: 219f.) Dies gilt besonders dann, wenn es ihnen gelingt, die verschiedenen überlokalen Ebenen gegeneinander auszuspielen (vgl. Clark 1974) oder diese durch Vermittlung oder Zurückhaltung wichtiger Informationen von sich "abhängig" zu machen (vgl. Garlichs 1980).
Aus den Ergebnissen wird ersichtlich,
dass sich in allen drei Landesteilen nur ein kleiner Bruchteil aller Gemeindeschreiber
einen Zuwachs an Gemeindeautonomie verspricht (Tab 8)Äusserst grosse interregionale
Unterschiede bestehen aber insofern, als in der deutschen Schweiz in sehr
hohem Ausmass negative Auswirkungen befürchtet werden, während
sowohl in der West- wie in der Südschweiz die Meinung überwiegt,
dass keine relevanten Veränderungen erwartet werden müssten. Nur im deutschen Sprachraum
ist also die Auffassung weit verbreitet, dass ein EU-Beitritt im Widerspruch
zum angestammten Gemeindeföderalismus stehen würde (und aus diesem
politischen
Grund abzulehnen sei). Dies mag zumindest teilweise damit zusammenhängen,
dass die Gemeinden in der deutschen Schweiz durchschnittlich eine höhere
Autonomie als in den zentralistisch konstituierten Westschweizer Kantonen
geniessen und dadurch eher der Meinung sind, im Falle einer europäischen
Integration ein wertvolles - im europäischen Kontext in mancher Hinsicht
einzigartiges - Stück ihrer traditionellen politischen Kultur zu verlieren.
Eine Analyse nach Grössenklassen macht deutlich, dass diese pessimistische Haltung bei den mittelgrossen Gemeinden (zwischen 1'000 und 10'000 Einwohnern) am häufigsten vorkommt, bei den Städten sich dagegen deutlich verringert. In der französischen und italienischen Schweiz sind die Unterschiede wenig konsistent: abgesehen von der Regularität, dass der Anteil derjenigen, die keine Prognose wagen, in grösseren Gemeinden eher sinkt. Ähnlich wie im Falle der demographischen und wirtschaftlichen Antizipationen hängt es nicht nur von der Bevölkerungszahl innerhalb der Gemeinde, sondern auch von den demographischen Bedingungen im kommunalen Umfeld ab, in welchem Masse positive oder negative Auswirkungen auf die Gemeindeautonomie wahrgenommen werden. Auch hier findet man den grössten Pessimismus bei den Schreibern jener Gemeinden, die weit ausserhalb der grossstädtischen Ballungsgürtel liegen, während die Repräsentanten stadtnaher Agglomerationsgemeinden am seltensten politische Autonomieverluste prognostizieren (Tab. 9). Wiederum zeigt sich, dass isolierte Land- und Berggemeinden den Wirkungen eines EU-Beitritts besonders defensiv und hilflos gegenüberstehen, während Agglomerations- und Stadtgemeinden offensichtlich eher die Möglichkeit erblicken, Einengungen ihrer Handlungsspielräume abzuwehren oder gar aus den sich neu eröffnenden Autonomiefeldern Nutzen zu ziehen.
Tabelle 9: Antizipierte Vor- und Nachteile eines EU-Beitritts für den politischen Handlungsspielraum der Gemeinde: nach Reisedistanz der Gemeinde zur nächsten Grosstadt Reisezeit zur nächsten
Grosstadt (100'000 oder mehr Einwohner) mit öffentlichen Verkehrsmitteln
(Gem. zwischen 250-5'000 Einwohnern)
Schliesslich scheinen die Beurteilungen der Gemeindeschreiber zumindest in der deutschen Schweiz auch von konkreten politischen Entwicklungen mitbeeinflusst zu sein, denen die Gemeinde in den vergangenen 10 Jahren ausgesetzt war. So finden sich die positivsten Beurteilungen bei jener - relativ kleinen - Gruppe von Gemeinden, die im - nach Ansicht derselben Informanten - im Zeitraum zwischen 1984 und 94 einen Zuwachs an Autonomie verzeichnen konnten, während in Kommunen mit Autonomieverlust am häufigsten pessimistische Meinungen geäussert werden. Tabelle 10: Antizipierte Vor- und Nachteile eines EU-Beitritts für den politischen Handlungs-spielraum der Gemeinde: nach Veränderung der Gemeindeautoomie 1984-94
Veränderung der Autonomie
der eigenen Gemeinde
7. Auswirkungen auf das Verhältnis der Gemeinde zu Bund und Kanton
Eine supranationale Einbindung
der Schweiz die EU hätte mit Sicherheit zur Folge, dass Bund, Kantone
und Gemeinden in dichtere vertikale Kommunikations- und Verflechtungszusammenhänge
eingebunden würden. So würden beispielsweise
intensivere Vernehmlassungsverfahren erforderlich sein, um die von den
Schweizer Repräsentanten in Brüssel vertretenen Standpunkt einvernehmlich
mit den Kantonen und Gemeinden festzulegen, und der Vollzug vieler europarechtlicher
Gesetze wird eine enge Kooperation zwischen den verschiedenen Verwaltungsebenen
notwendig machen (vgl. Schindler 1992:202). Dadurch würden die Beziehungen
der Gemeinden zu Bund und Kanton anforderungsreicher und vermehrt dem Risiko
ausgesetzt, dass Meinungsverschiedenheiten oder Konflikte ausgetragen werden
müssten. Es ist einleuchtend, dass Voraussagen
darüber, ob diese Beziehungen eher "besser" oder "schlechter" würden,
grossen objektiven Unsicherheiten unterliegen. Dadurch wird verständlich,
warum sich hier besonders zahlreiche Gemeindeschreiber - vor allem wiederum
in der Westschweiz und im Tessin - ausserstande sehen, eine Antwort zu
geben (Tab. 11).
Im übrigen fällt auf, dass im Vergleich zu den eher negativen Antizipationen hinsichtlich der kommunalen Autonomie in der deutschen Schweiz seltener negative und im französischen Sprachraum erheblich häufiger positive Beurteilungen geäussert werden. Für mehr als 20% aller Westschweizer Informanten gibt es also offensichtlich auch staatspolitische Gründe, um zu einem EU-Beitritt der Schweiz befürwortend Stellung zu beziehen. Damit kontrastieren sie nicht nur mit ihren Kollegen in der Deutschschweiz, sondern noch drastischer mit denjenigen im Tessin, wo nur eine kleine Minderheit der Befragten vorteilhafte Konsequenzen vorauszusehen glauben.

Auch bei einer Aufgliederung
nach Grössenklassen zeigt das Tessin eine Sonderstellung, insofern
nur hier die Beurteilungen nicht konsistent mit der Bevölkerungsgrösse
kovariieren. In den beiden anderen Landesteilen
sind es eindeutig die Städte, die am seltensten negative und am häufigsten
positive Auswirkungen sehen, andererseits aber - insbesondere in der Westschweiz
- am häufigsten der Meinung sind, durch den europäischen Integrationsprozess
werde ihre Stellung gegenüber den überlokalen Ebenen in keiner
relevanten Weise berührt. Wiederum zeigt es sich, dass
isolierte ländlichen Gemeinden ausserhalb der grossen urbanen Agglomerationen
am häufigsten negative Auswirkungen befürchten, während
suburbane Kommunen der deutschen Schweiz überdurchschnittlich häufig
optimistische Meinungen vertreten (Tab. 12). Noch häufiger sind positive
Antizipationen bei jenen Gemeinden, die in den vergangenen zehn Jahren
ein Anwachsen ihrer kommunalen Autonomie erfahren haben (und dementsprechend
eher Gründe sehen, um an positive Entwicklungstendenzen ihrer überlokalen
Einbindungen zu glauben, Tab. 13).
Tabelle 12: Antizipierte Vor- und Nachteile eines EU-Beitritts für das Verhältnis der Gemeinde zu Bund und Kanton: nach Reisedistanz der Gemeinde zur nächsten Grossstadt Reisezeit zur nächsten
Grosstadt (100'000 oder mehr Einwohner) mit öffentlichen Verkehrsmitteln
(Gem. zwischen 250-5'000 Einwohnern)
Tabelle 13: Antizipierte Vor- und Nachteile eines EU-Beitritts für das Verhältnis der Gemeinde zu Bund und Kanton: nach Veränderung der Gemeindeautonomie 1984-94 Veränderung der Autonomie
der eigenen Gemeinde
In Übereinstimmung mit den demoskopischen Umfragen und den Abstimmungsergebnissen (insbesondere zur EWR Vorlage am 6. Dez. 1992) zeigt sich im vorliegenden Fall, dass hinsichtlich der antizipierten kommunalen Auswirkungen eines EU-Beitritts im deutschen Sprachraum die negativsten und in der französischen Schweiz die positivsten Meinungen bestehen, während das Tessin eine - generell eher der Deutschschweiz ähnelnde - Mitttelstellung einnimmt. Im Unterschied zu den Volksabstimmungen mit ihren harten Ja-Nein-Alternativen wird die Polarisierung allerdings dadurch stark gemildert, dass überall die Mehrheit aller Informanten erklärt, dass die Auswirkungen inexistent oder nicht voraussagbar seien. Die übrigen entscheiden sich in der deutschen Schweiz überall mehrheitlich für eine pessimistische Stellungnahme, während im französischen Sprachraum insbesondere bei den Beurteilung der demographischen und wirtschaftlichen Konsequenzen (aber auch hinsichtlich der zu erwartenden Veränderungen im Verhältnis der Gemeinde zu Bund und Kanton) positive Stimmen überwiegen. Die Divergenzen zwischen der deutschen Schweiz und der Romandie werden auch durch die Beobachtung relativiert, dass sie am stärksten bei den kleineren (besonders den ausserhalb der Agglomerationsgürtel liegenden) Gemeinden in Erscheinung treten, während die Städte (und in teilweise auch die suburbanen Kommunen) beider Sprachregionen zumindest in der Beurteilung wirtschaftlicher und staatspolitischer Auswirkungen relativ stark konvergieren. Auch in multivariaten Regressionsanalysen bestätigt sich die Vermutung, dass die Sprachregion überall ein unabhängiger Erklärungsfaktor darstellt, der seine Determinationswirkung auch bei statistischer Kontrolle beliebiger anderer Faktoren (z.B. demographischer und sozio-ökonomischer Art) beibehält. In zweiter Linie erscheint in diesen Gleichungen praktisch überall die Variable "Distanz zur Grosstadt": und zwar immer in der Weise, dass die Schreiber stadtnaher, suburbaner Kommunen zu einer positiveren Beurteilung neigen als die Informanten isolierter Land- und Berggemeinden, die dem europäischen Integrationsprozess defensiver und ängstlicher gegenüberstehen. Die Agglomerationsgemeinden scheinen sich in mancher Hinsicht die Einstellungen der grösseren Städte - die ihrerseits recht optimistisch votieren - zu eigen zu machen, da sie vielleicht die Möglichkeit sehen, im Verbund mit ihnen die positiven Chancen eines Beitritts (z.B. ökonomischer Art) besser auszuschöpfen und den negativen Konsequenzen (z.B. politisch-administrativer Art) wirkungsvoller zu begegnen. Dies alles gilt allerdings nicht für das Tessin, dessen Gemeinden alle insofern ähnlich sind, dass sie sich in weiter Verkehrsdistanz zur nächsten Schweizer Grosstadt befinden. Im Gegensatz zu den beiden übrigen Sprachregionen sind es hier die grösseren Gemeinden, die sowohl auf der demographischen wie auf der ökonomischen Ebene am häufigsten negative Konsequenzen antizipieren (und auch in den politisch-administrativen Aspekten keinen grösseren Optimismus als die Kleinstgemeinden zeigen).
Im Vergleich zur Sprachregion,
Bevölkerungsgrösse und geographischen Lage bleibt die kausale
Bedeutung anderer Faktoren gering und auf einzelne Aspekte begrenzt. Im besonderen gibt es keine
Hinweise dafür, dass Gemeinden mit gut ausgebildeter und wohlhabender
Bevölkerung und/oder mit moderner Wirtschaftsstruktur der Frage einer
europäischen Integration der Schweiz offener gegenüberstünden.
Literatur Allenbach, Beat / Aschinger, Richard: Im Tessin wächst die Skepsis gegenüber Europa (Tages Anzeiger, 25.7.1992: 2). Bruha, Thomas: Das Subsidiaritätsprinzip im Recht der Europäischen Gemeinschaft (in: Riklin, Alois/Batlinger Gerard (Hrsg.) Subsidiarität. Ein interdisziplinäres Symposium. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1994: 373-410). Clark, T.N.: Community Autonomy in the National System: Federalism, Localism and Decentralization (in: derselbe (ed.) Comparative Community Politics. Halsted Press Division, John Wiley & Sons, New York, 1974). Garlichs, Dietrich: Politikformulierung und Implementierung im föderativen Staat (in: Mayntz, Renate (Hrsg.) Implementation politischer Programme, Athenäum u.a., Königstein Ts. 1980: 20-35). Geser, Hans: Ohne "Gemeinschaft" gäbe es mehr Alternativen: kleinstaatliche (und andere) Vorbehalte gegen ein antiquiertes Konzept europäischer Integration (in: Kriesi, H.P. (Hrsg.) Die Schweiz und Europa, Jahrbuch der Schweiz. Vereinigung für Politische Wissenschaft, Bd. 32, 1992: 389-416). Geser, Hans: "Subsidiarität" im gesellschaftlichen Wandel (in: Riklin, Alois/Batlinger, Gerard (Hrsg.) Subsidiarität. Ein interdisziplinäres Symposium. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1994: 163-192). Hug, Peter: Die Behörden spielen die Folgen des EWR herunter (Tages Anzeiger, 20.1.1992: 2). Jagmetti Riccardo: Der EWR und die Demokratie (Neue Zürcher Zeitung 5.9.1991: 23). Kux, Stephan: Föderalisierung Europas - Europäisierung des Föderalismus (in: Kriesi, H.P. (Hrsg.) Die Schweiz und Europa, Jahrbuch der Schweiz. Vereinigung für Politische Wissenschaft, Bd. 32, 1992: 83-106). Lareida, Kurt: Finanzautonomie der Kantone im neuen Europa (Neue Zürcher Zeitung, 9.10.1991: 23). Müller, Georg: Die europäische Integration als Anstoss - nicht als Zwang zur innenpolitischen Reform (Neue Zürcher Zeitung, 3. März 1992: 21). Schindler, Dietrich: Schweizerischer und Europäischer Föderalismus (Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht, 93, 1992: 193-223). Schnabel, F.: Politik ohne Politiker (in: Wollmann, H. (Hrsg.) Politik im Dickicht der Bürokratie. Westdeutscher Verlag, Opladen 1980: 49-70). Schoch, Claudia: Anpassung des Schweizer Rechts an den EWR (Neue Zürcher Zeitung, 7.2.1992: 23). Thürer, Daniel: Die schweizerische Bundesversammlung und die europäische Gemeinschaft - zu den Chancen einer verstärkten parlamentarischen Legitimierung des europäischen Gemeinschaftsrechts im nationalen Rahmen (in: Parlamentsdienste (Hrsg.) Das Parlament - oberste Gewalt des Bundes? Haupt Verlag, Bern 1991a: 443-473). Thürer, Daniel: Der Verfassungsstaat als Glied einer europäischen Gemeinschaft (Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer 50, 1991, De Gruyter, Berlin/New York, 1991b: 99-136). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
|
aktualisiert am 26.08.2014
.gif)