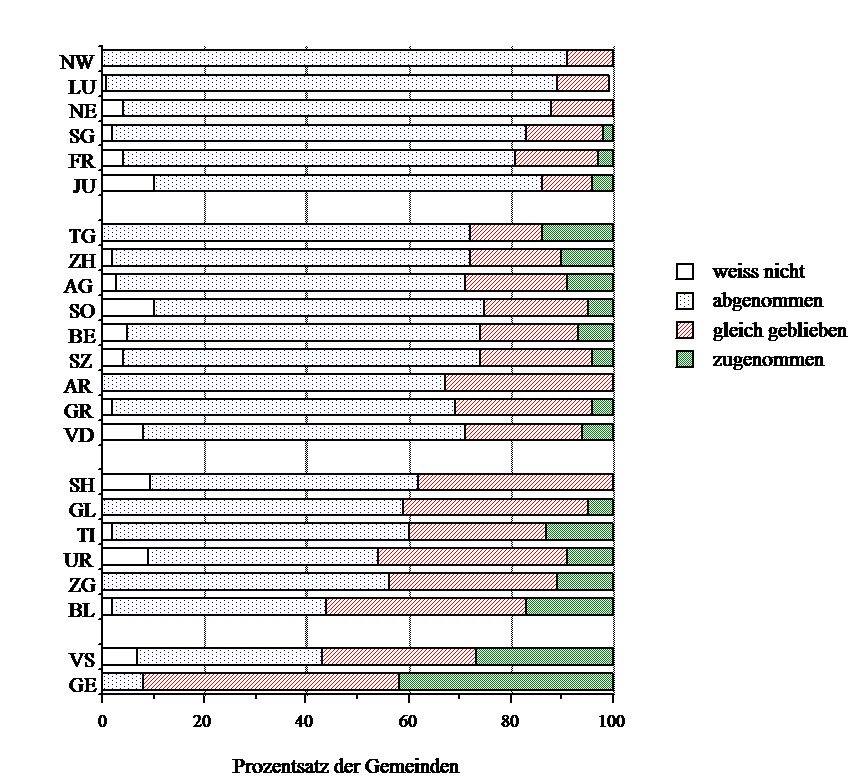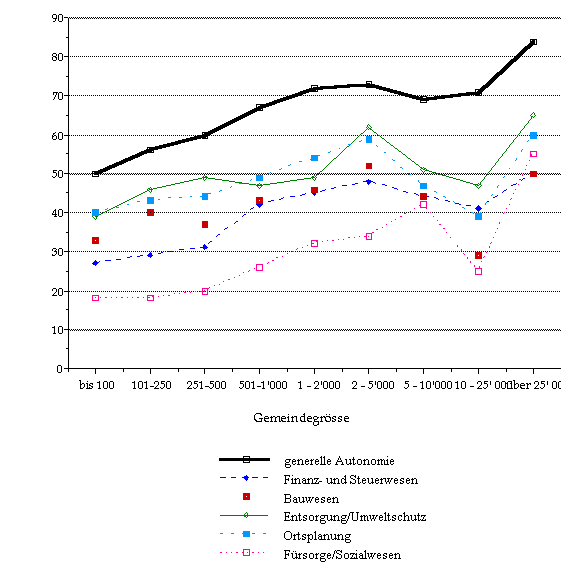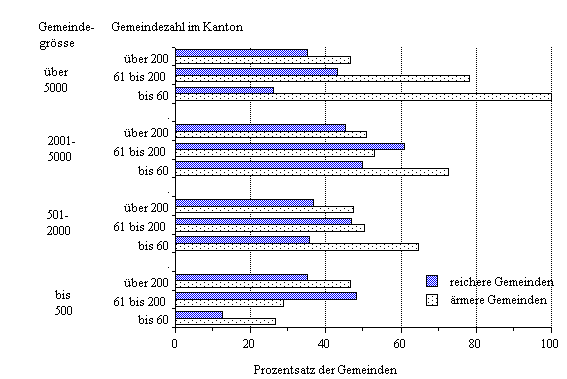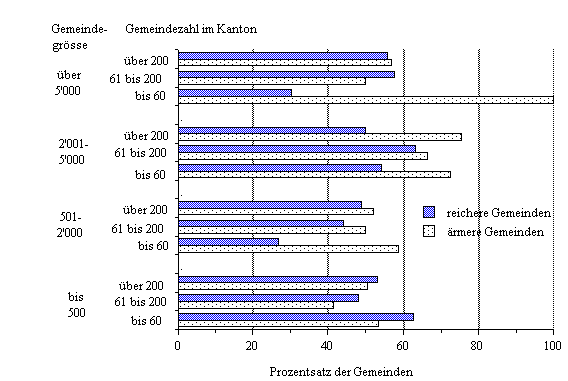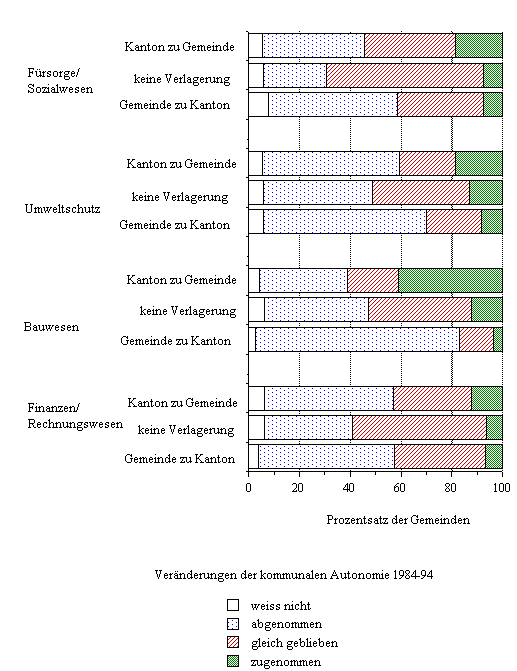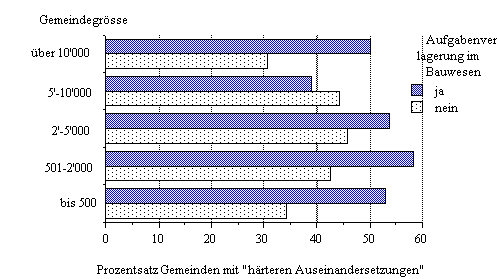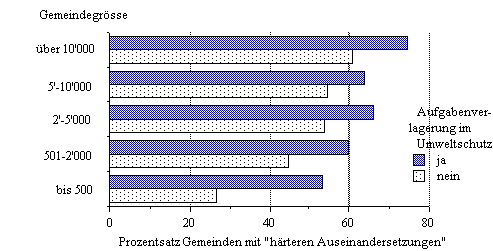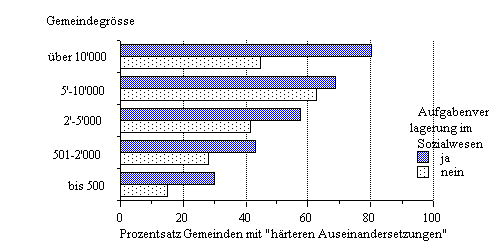|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Beziehungen der Gemeinde zur kantonalen Ebene
Ein Beitrag
im Rahmen des Nationalfondsprojektes:
Hans Geser Dezember 1996
Zusammenfassung Die Ergebnisse einer gesamtschweizerischen
Untersuchung gibt Aufschluss, wie sich die Kooperations- und Abhängigkeitsbeziehungen
der Gemeinden zu den Kantonen im Zeitraum 1984 bis 1994 verändert
haben.
Es zeigt sich, dass die Mehrzahl
der Gemeinden in dieser Periode gleichzeitig eine Zunahme der kommunalen
Aufgaben und eine Verringerung der kommunalen Autonomie registrieren.
Gleichzeitig bestätigen
sich aber auch die differenzierenden Hypothesen der "Politikverflechtungstheorie",
die besagen, dass die Gemeinden als Folge dieser eben genannten Doppelentwicklung
keineswegs nur eine Einengung angestammter Handlungsspielräume, sondern
auch eine gewisse Expansion neuer Spielräume erfahren.
Erwartungsgemäss werden
derartige Entwicklungen auch durch Eigenheiten der Gemeinde und ihres politischen
Umfelds mitbeeinflusst. So zeigt sich, dass wohlhabendere und in kleineren
Kantonen beheimatete Gemeinden besonders gut in der Lage gewesen sind,
ihren angestammten Autonomiespielraum beizubehalten oder gar zu expandieren.
Inhalt
1. Methodische Hinweise Die vorliegende Studie basiert auf einer im Jahre 1994 am Soziologischen Institut der Universität Zürich durchgeführten schriftlichen Befragung. Finanziert wurde sie vom Schweizerischen Nationalfonds. Die Untersuchung richtete sich an die Gemeindeschreiberinnen und Gemeindeschreiber sämtlicher 3'017 Schweizer Gemeinden (Stand 1. Jan. 1994). Insgesamt haben 2'079 Gemeinden an der Befragung teilgenommen und die Beteiligung ist mit einem Rücklauf von knapp 70 Prozent ausgesprochen hoch ausgefallen. Die für die vorliegenden Arbeiten verwendeten Daten stammen nicht nur aus der Befragung von 1994. Als Ergänzung sind noch andere Zahlen in die Analyse einbezogen worden, so jene des Soziologen Rolf Nef, der für seine Analysen über kommunales Wahlverhalten Datensätze demographischer, ökologischer und sozioökonomischer Art für sämtliche Gemeinden der Schweiz zusammengetragen hat. Dabei handelt es sich vor allem um Volkszählungsdaten, Betriebszählungsdaten und Wehrsteuerstatistiken. Ausserdem konnten wir auch auf Daten eines eigenen Forschungsprojektes zurückgreifen, die 1988 durch eine erste Befragung der Gemeindeschreiber und Gemeindeschreiberinnen sämtlicher Gemeinden der Schweiz erhoben wurden. Diese Befragung erzielte einen Rücklauf von über 80 Prozent, so dass sie uns für die Analyse des Wandels der politisch-administrativen und der kommunalpolitischen Organisation der Gemeinden im allgemeinen und des kommunalen Parteiwesens im besonderen sehr aussagekräftige Resultate lieferte. 2. Beurteilungen der aktuellen Gemeindeautonomie In einem komplexen Staatswesen wie der Schweiz nimmt auch der Begriff "Gemeindeautonomie" eine äusserst fazettenreiche Bedeutung an. Bei einer empirischen Erfassung dieses Konzepts stösst man vor allem auf die Schwierigkeit,
Eine Möglichkeit, sich den Forschungsaufwand zu vereinfachen, besteht für den Soziologen in dieser Situation darin, sich auf die Beurteilungen zu verlassen, wie sie von kenntnisreichen und im kommunalen Aktionsfeld zentral engagierten Personen (in unserem Falle: den Gemeindeschreibern) selber vorgenommen werden. Natürlich wird es sich bei derartigen Einschätzungen um das Ergebnis höchst komplexer (und dementsprechend auch stark individuell bestimmten) kognitiver Wahrnehmungs- und Bewertungsprozesse handeln, die überdies erheblich davon abhängen, welche Vergleichskriterien von den Beurteilern angewendet werden. Konkreter gesagt: Wenn ein Schreiber seine Gemeinde als "sehr wenig autonom" bezeichnet, weiss man nicht
Andererseits müssen solche
Beurteilungen ungeachtet ihrer empirischen "Richtigkeit" und evaluativen
Kriterien durchaus als "soziologische Realitäten sui generis" aufgefasst
werden: und zwar umso mehr, je hochrangiger und einflussreicher die Personen
sind, von denen sie stammen.
Wenn beispielsweise unter Gemeindepolitikern
und -beamten das Gefühl verbreitet ist, die Gemeinden würden
immer stärker von der Kantonalverwaltung dominiert, liegt ein realer
- z.B. von den Kantonsbehörden ernstzunehmender - Zustand kollektiver
Unzufriedenheit vor, der zukünftig den Anlass für allerhand Protesthandlungen
oder kollektive Reformbemühungen bilden kann.
Dennoch darf damit gerechnet
werden, dass derartige Beurteilungen auf der Basis tatsächlicher politisch-administrativer
Entwicklungstendenzen getroffen werden und wenn auch nicht in jedem einzelnen
Fall, so doch vielleicht in ihrer durchschnittlichen Gesamtheit als Indikatoren
für derartige Realverhältnisse gewertet werden dürfen.
Dies gilt erfahrungsgemäss
vor allem dann, wenn nach ganz spezifischen Autonomieaspekten (z.B. innerhalb
bestimmter Vollzugsbereichen) gefragt wird, weil dann das Risiko wegfällt,
dass verschiedene Informanten ihr Urteil auf völlig unterschiedliche
Sektoren öffentlicher Tätigkeit beziehen.
Die Ergebnisse zeigen, dass
die gewählten Skalenwerte zwar über das gesamte verfügbare
Kontinuum streuen, sich aber schwerpunktmässig bei niedrigen und mittleren
Skalenwerten (bis sechs) konzentrieren. In Gemeinden aller Grössenklassen
neigen offensichtlich weniger als 20% der Informanten zur Ansicht, ihre
Gemeinde verfüge momentan über eine hohe (oder gar sehr hohe)
Autonomie. Kleine Gemeinden unterscheiden sich von grösseren ausschliesslich
dadurch, dass sie sich etwas häufiger am äussersten unteren Skalenende
positionieren (Figur 1). Diese nicht überraschende Regularität
wird durch einen weniger leicht erklärbaren Trend kurvilinearer Natur
überlagert, der darin sichtbar wird, dass die kommunale Autonomie
bei einer mittleren Gemeindegrösse zwischen 500 und 1'000 Einwohnern)
auf ein Minimum sinkt (Figur 1).
Bei einer Aufgliederung nach Kantonen zeigt sich erwartungsgemäss, dass die Gemeinden der Westschweizer Kantone - mit Ausnahme des Wallis - eine besonders geringe Autonomie gegenüber der kantonalen Ebene verspüren (Figur 2). Ganz besonders gilt dies für den Kanton Genf, wo die Gemeinden - gemäss objektiven Indikatoren der Rechtssetzung und Budgetmittel - bekanntermassen über die geringsten politischen Entscheidungsspielräume verfügen (vgl. Schuler et. al. 1995: passim). Innerhalb der deutschen Schweiz sind es - mit Ausnahme von Zürich - kleinere und ländliche Kantone, in denen die höchste - wahrgenommene - Gemeindeautonomie besteht. Auffällig ist die deviante Position des Kantons Luzern, der neuerdings sogar die Kantone Waadt, Freiburg und Tessin an Zentralismus übertrifft. Figur 2: Autonomie der Gemeinden gegenüber dem Kanton: nach Kantonen*
Verschiedene zusätzliche Analysen, die hier nicht vorgeführt werden, bestätigen den Eindruck, dass die kommunale Autonomie primär von kontextuellen Faktoren determiniert wird, während gemeindeinterne Merkmale (wie Bevölkerungsgrösse, Wohlstandsniveau und ähnliches), relativ unbedeutend sind. Vor allem erweist es sich als bedeutsam, ob sich die Gemeinde in einem Kanton mit relativ wenigen oder relativ zahlreichen Gemeinden befindet. So wird die generelle Autonomie in Kantonen mit geringer Gemeindezahl weitaus am günstigsten beurteilt, während bei einer Zahl von über 200 Gemeinden am häufigsten sehr niedrige (und am seltensten sehr hohe) Skaleneinstufungen erfolgen (Figur 3). Figur 3: Autonomie der Gemeinden gegenüber dem Kanton: nach Anzahl Gemeinden im Kanton*
Verschiedene theoretische Ursachen dieser Regularität sind denkbar:
Im Sinne dieser drei - zueinander durchaus komplementären - Hypothesen hat sich beispielsweise in früheren Untersuchungen gezeigt, dass gemeindereiche Grosskantone am stärksten dazu neigen, sehr detaillierte (=paragraphenreiche) Verwaltungsgesetze zu erlassen, in denen vor allem die Pflichten der Gemeinden gegenüber dem Kanton (sowie die Kompetenzen kantonaler Organe gegenüber den Gemeinden) einen grossen Umfang erhalten (vgl. Geser 1981: 263ff.). Die beiden ersten Hypothesen implizieren, dass die Kommunen gemeindereicher Kantone insgesamt (d.h. ungeachtet ihrer Grösse) einen niedrigen Autonomiestatus besitzen, während in Kanton mit wenig Gemeinden beispielsweise die Städte weitaus besser als kleine Dörfer in der Lage wären, sich im informellen Umgang mit der Kantonsebene günstige Positionen zu verschaffen. Die dritte Hypothese dagegen sagt voraus, dass Unterschiede der Gemeindegrösse auch in Kantonen mit vielen Gemeinden bedeutsam bleiben: z.B. weil der kantonale Verwaltungsapparat seine Überlegenheit gegenüber kleinen Gemeinden besser als gegenüber den Städten zur Geltung bringen kann.
Die Ergebnisse sprechen eher
für die erste oder zweite Hypothese, weil sich kleine und grosse Gemeinden
in den Kantonen mit geringster Gemeindezahl am stärksten (und bei
höchster Gemeindezahl am wenigsten) voneinander unterscheiden (Figur
4). So zeigt sich eindeutig, dass
in den "grossen" Kantonen Gemeinden aller Grössenklassen ein geringes
Mass an Autonomie hinnehmen müssen, während die grössten
Gemeinden weitaus die höchste Autonomie besitzen, wenn sie sich in
Kantonen mit geringer Gemeindezahl befinden. Eher überraschend ist
hingegen das Ergebnis, dass es in Kantonen mit geringer Gemeindezahl nicht
die kleinsten, sondern die mittelgrossen Kommunen sind, die am häufigsten
eine niedrige Autonomieposition vermelden.
1. Kleine Gemeinden (unter 500 Einwohner)
2. Mittlere Gemeinden (2'000-5'000 Einwohner)
3. Grössere Gemeinden (über 10'000 Einwohner)
3. Aufgabenverschiebungen zwischen kommunaler und kantonaler Ebene In den meisten Vollzugsbereichen kann man feststellen, dass sich mit zunehmendem Umfang und wachsender Komplexität der Aufgaben der Schwerpunkt der Tätigkeiten immer mehr vom Zentralstaat auf niedrigere, substaatliche Ebenen verlagert (vgl. Kap. 1). So hat der Ausbau des Sozial-, Gesundheits- und Bildungswesens zu einem disproportionalen Ausbau kantonaler und kommunaler (vor allem: städtischer) Institutionen und Anstalten geführt, während die klassischen Regiebetriebe des Bundes (PTT, SBB) eher Arbeitsplätze abgebaut haben oder im Zuge von Privatisierungsmassnahmen gar daran sind, völlig zu verschwinden. Analog dazu gilt für den Verwaltungsbereich, dass beispielsweise Verbesserungen in der Arbeitslosenbetreuung, Verschärfungen in der Baubewilligungspraxis oder straffere Massnahmen im Umweltschutz nur insofern realisierbar sind, als der gesetzgebende Bundesstaat sich auf kompetente Vollzugsapparate auf der Ebene der Kantone, Bezirke oder Gemeinden verlassen kann, die zumindest auf operativer Ebene leistungsfähig und zuverlässig sind. Der zunehmende Ruf nach einer "bürgernahen" Verwaltung kann zusätzlich dazu beitragen, vielerlei öffentliche Leistungen sehr dezentralisiert (möglichst in "Gehdistanz" jedes einzelnen Nutzers) anzubieten. In vielen Staaten (vor allem Nordeuropas) haben diese Entwicklungen zu gross angelegten Gebietsreformen geführt, die das Ziel hatten, durch Elimination kleinerer, strukturschwacher Gemeinden die Leistungsfähigkeit der kommunalen Ebene zu verstärken. In der Schweiz hingegen ist die im 19. Jahrhundert entstandene kleinräumige Gemeindestruktur fast unbeschadet erhalten geblieben, so dass die Kantone häufig nicht in der Lage sind, ihre Aufgaben an kommunale Vollzugsträger zu delegieren. So ist es zu erklären, warum die meisten Kantone beispielsweise Mittelschulen oder Kliniken nach wie vor in eigener Regie betreiben und sich im Falle von Dezentralisierungen eher auf überkommunale Substrukturen ("Bezirke" oder "Ämter") abzustützen pflegen, die sich im Gegensatz zu Gemeinden unter direkter kantonaler Kontrollgewalt befinden. Empirisch kommt dies beispielsweise darin zum Ausdruck, dass der Anteil der Kantone am gesamten öffentlichen Personalbestand zwar seit Jahrzehnten zunimmt, der Anteil der Gemeinden - im Unterschied zu den meisten westlichen Ländern - dagegen eher stagniert. Im Lichte dieser Überlegungen liegt die Hypothese nahe, dass zwar auch in der Schweiz in den letzten Jahren eher Aufgabenverlagerungen vom Kanton auf die Gemeinden als von der Gemeinde zum Kanton stattgefunden haben, dass derartige Entwicklungen aber eher gebremst ablaufen und sich auf grössere Gemeinden beschränken. In Übereinstimmung mit diesen Vermutungen zeigt Tabelle 1, dass
Eine Ausnahme zur zweiten Regularität bildet allerdings das Steuerwesen, wo auch die Mehrheit der Berner und der Neuenburger Gemeinden berichtet, dass eine Verlagerung auf die Kantonsebene stattgefunden habe. Die Ergebnisse bieten auch keinerlei Anlass, um von einer generellen, alle Vollzugsbereiche übergreifenden Verlagerungswelle zu sprechen. Am ehesten scheinen die Gemeinden einerseits im Umweltschutz (und den eng damit verknüpften Aufgaben der Abfallentsorgung) sowie im Fürsorgewesen verstärkt in die Pflicht genommen zu werden. Demgegenüber scheint sich beispielsweise im Finanz- und Gesundheitswesen (wie auch in den hier nicht aufgeführten Bereichen des Ortsbildschutzes, der Jugendfragen und des Schulwesens) in der Mehrheit der Kantone eine stabile Aufgabenteilung eingespielt zu haben. Überraschenderweise scheint sich die Tendenz zu Aufgabenverlagerungen in hohem Masse auf den deutschen Sprachraum zu beschränken. Stabilität überwiegt insbesondere in den Kantonen Waadt, Neuenburg und Jura, wo es in keinem einzigen Vollzugsbereich vorkommt, dass die Gemeinden mehrheitlich einen Wandel in der Aufgabenverteilung melden. Ganz offensichtlich hat sich in der Westschweiz (und auch im Tessin) ein gewisser administrativer Zentralismus erhalten, der dazu führt, dass neu auftretende Aufgaben weitgehend vom kantonalen Verwaltungsapparat (bzw. von seinen "Filialen" auf Bezirksebene) bewältigt werden. Diese regionalen Unterschiede legen den Schluss nahe, dass die Kausalbeziehungen zwischen dem Umfang öffentlicher Tätigkeit und deren Verteilung auf verschiedene Vollzugsebenen keineswegs deterministisch sind, sondern durch intervenierende kulturelle Variablen (im vorliegenden Falle wohl: die unterschiedliche Gewichtung des Gemeindeföderalismus) mitbeeinflusst werden. Tabelle 1: Aufgabenverlagerungen zwischen Kanton und Gemeinden in verschiedenen Vollzugsbereichen (1984-94): nach Kantonen
Lesebeispiele: Dessen ungeachtet stellt sich die Frage, welche strukturellen Faktoren für die erheblichen Unterschiede zwischen den Kantonen (wie auch zwischen Gemeinden desselben Kantons) verantwortlich sind. Aus organisationssoziologischer Sicht ist hier in erster Linie an die Kantonsgrösse und die Gemeindegrösse zu denken:
So mögen beispielsweise städtische
Gemeinden ihre eigenen kommunalen Polizeikorps, Jugendsekretariate oder
Steuerveranlagungsabteilungen ausbilden, während Kleingemeinden keine
andere Wahl haben, als die auf Kantons- oder Bezirksebene bereitgestellten
Organisationen oder Amtsstellen zu benutzen. Ebenso mag sich ein auf "Abschlankung"
bedachter Kanton vor allem von jenen Aufgaben entlasten, die - wie z.B.
kulturelle Aktivitäten - ohnehin nur für grössere Gemeinden
Bedeutung haben (und von diesen deshalb durchaus im eigenen Interesse übernommen
werden). Aus der Kombination beider
Hypothesen ergibt sich die Vermutung, dass grössere Gemeinden grösserer
Kantone wahrscheinlich am häufigsten einen Aufgabenzuwachs verzeichnen. Umgekehrt dürften die
Kleingemeinden grosser Kantone am seltensten zusätzlich belastet werden,
weil der kantonale Vollzugsapparat umfangreich genug ist, um ihre Leistungsmängel
durch eine gut ausgebaute Kantons- und Bezirksverwaltung zu kompensieren. Diese Vermutungen werden in
überraschend hohem Umfang bestätigt. Denn sowohl im Finanzbereich
wie im Bauwesen, Umweltschutz und Sozialwesen sind es die städtischen
Gemeinden der grösseren Kantone (mit über 300'000 Einw.), die
am häufigsten einen Aufgabenzuwachs vermelden, während sich bei
den Kleinstgemeinden dieser selben Kantone die geringsten Prozentwerte
finden (Tabelle 2). Demgegenüber bleiben
die Prozentanteile in den kleinen Kantonen (mit unter 60 Gemeinden) bei
kleinen wie bei grösseren Gemeinden auf relativ niedrigem Niveau.
1. Bauwesen Einwohnerzahl des Kantons (in 1000)
2. Umweltschutz
3. Fürsorgewesen
4. Veränderungen in der generellen Gemeindeautonomie Eine Mehrheit von fast 65% aller Gemeindeschreiber(innen) sind der Ansicht, dass die Autonomie ihrer Gemeinde seit 1984 generell (d. h.. gemittelt über alle Vollzugsbereiche) abgenommen habe. Von den übrigen stellen 22% keine Änderungen fest; und nur (oder immerhin?) 7,5% sind der Meinung, dass ein Zuwachs an kommunaler Selbständigkeit stattgefunden habe. Diese pessimistische Einschätzung ist sehr breit über grosse und kleine Kantone und die verschiedenen Sprachregionen gestreut; nur in den Kantonen Genf und Wallis liegt der Prozentanteil der Informanten, die eine Autonomiezunahme registrieren, über 20%. Die negativsten Beurteilungen stammen aus den Kantonen Nidwalden, Luzern und Neuenburg, wo weit über 80% der Gemeinden einen Verlust an Eigenständigkeit vermelden (und überhaupt niemand zu einer positiven Einschätzung gelangt) (Figur 5). Figur 5: Entwicklung der Gemeindeautonomie 1984-94: nach Kantonen
Die auffälligste Ausnahme vom allgemeinen Trend bildet der Kanton Genf, wo nach allgemeiner Einschätzung günstige Entwicklungen (oder zumindest eine Bewahrung des Status quo) wahrgenommen werden. Offensichtlich sind in diesem - traditionell sehr zentralistischen - Kanton in jüngster Zeit einige Kehrtwendungen eingetreten, die zum sehr ausgeprägten Konzentrationsprozess mancher Deutschschweizer Kantone in einem Kontrastverhältnis stehen. Auch die relativ günstige Bilanz anderer zentralistischer Kantone (Tessin und Waadt) gibt Anlass zur Vermutung, dass die traditionell sehr hohen interregionalen Unterschiede im Autonomiestatus der Gemeinden dabei sind, sich zu nivellieren. Die verfügbaren empirischen Befunde genügen aber keineswegs, um eine derart weitgehende Hypothese zu überprüfen. Gegen die These einer Nivellierung spricht vor allem die Regularität, dass ausgerechnet die Gemeinden jener grösseren (d.h. gemeindereicheren) Kantone, die ohnehin zu einer stärkeren Zentralisierung und Reglementierung neigen, am häufigsten einen Autonomieverlust (und am seltensten eine Zunahme ihrer Selbständigkeit) erfahren haben. Seltsamerweise gilt dies am stärksten für die Städte, in diesen Grosskantonen zu über 90% (!) eine Abnahme vermelden. Damit unterscheiden sie sich drastisch von den kleineren Kantonen, wo - genau umgekehrt - die Chance von Autonomiegewinnen mit zunehmender Gemeindegrösse steigt (Tab. 3). Tabelle 3: Prozentsatz der Gemeinden, deren generelle Autonomie zwischen 1984 und 1994 zugenommen bzw. abgenommen hat: nach Gemeindegrösse und Gemeindezahl des Kantons Anzahl Gemeinden im Kanton (in 1000)
Zur Erklärung dieses Phänomens mag man bedenken,
Die Vermutung liegt nahe, dass diese strukturelle Machtstellung der Gemeinden gegenüber dem Kanton nicht nur von demographischen Grössenrelationen, sondern auch von ökonomischen Faktoren abhängig ist. So ist zu erwarten, dass wohlhabendere Gemeinden weniger Autonomieverluste hinnehmen müssen, weil sie beispielsweise besser in der Lage sind, vielerlei Dienstleistungen, Einrichtungen und Projekte in eigener Regie (d.h. ohne Subventionszuschüsse, die meist mit Auflagen verbunden sind) zu betreiben oder gar - z.B. als Nettozahler im Finanzausgleich - auf das Verhalten des Kantons oder anderer Gemeinden Einfluss zu nehmen. Die Ergebnisse zeigen, dass dies insbesondere für mittlere und grössere Gemeinden, die sich in kleineren Kantonen befinden, in hohem Masse gilt (Figur 6 ). Bei den Kantonen mit sehr zahlreichen Gemeinden stellt man insofern eine Umkehrung fest, als dort die grossen wohlhabenden Gemeinden sogar häufiger als ihre ärmeren Schwestergemeinden einen Autonomieverlust hinzunehmen hatten. Der Grund für diese überraschend grosse Bedeutung des kantonalen Umfelds liegt wohl darin, dass grosse Kantone aufgrund des hohen absoluten Umfangs ihrer finanziellen und personellen Mittel in der Lage sind, selbst ihre steuerkräftigsten (und grössten) Gemeinden in starker Abhängigkeit zu halten [1]. Figur 6: Abnahme der generellen Gemeindeautonomie 1984-94: nach Grösse und Wohlstandsniveau der Gemeinde und nach Gemeindezahl des Kantons
Den Kleinstgemeinden (unter
500 Einwohnern) ist es offensichtlich unabhängig von ihrer ökonomischen
Situation am häufigsten gelungen, ihren Autonomiestatus unbeschadet
zu erhalten. Dies hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass sie relativ
wenig neue Aufgaben zu bewältigen haben und deshalb - trotz ihrer
geringen Kapazitäten auf finanzieller und personeller Ebene - relativ
selten auf akute Leistungsgrenzen stossen (vgl. Kap.) Anders gesagt: Kleinstgemeinden
sehen sich eher selten vor Probleme gestellt, zu deren Bewältigung
sie sich - wenn sie finanziell auf schwachen Füssen stehen - in die
Abhängigkeit kantonaler Organe oder anderer überlokaler Instanzen
begeben müssen.
5. Autonomiewandel in einzelnen Vollzugsbereichen Weil die Gesamtaktivität eines modernen Staates in eine Vielzahl voneinander separierter Vollzugsfelder mit je eigenen legislativen, finanziellen und organisatorischen Bedingungen und Entwicklungen zerfällt, ist damit zu rechnen, dass sich auch die kommunale Autonomie in verschiedenen Verwaltungssektoren auf sehr unterschiedliche, ja teilweise wohl gegensätzliche Weise verändert. Figur 7: Prozentsatz der Gemeinden, die zwischen 1984 und 1994 in verschiedenen Vollzugsbereichen Autonomie verloren haben: nach Gemeindegrösse Prozentsatz
So zeigt sich, dass die Gemeinden
insbesondere in den auf physische Objekte bezogenen Vollzugsfeldern (Bauwesen,
Umweltschutz/Entsorgung und Raumplanung) häufig an Selbständigkeit
verloren haben, während sie in den auf menschliche Subjekte ausgerichteten
Handlungsfeldern (z.B. Fürsorge, aber auch Schule und Jugendfragen)
meist in der Lage waren, ihre angestammte Autonomie aufrechtzuerhalten
(Figur 7). Andererseits drängt sich
aber der Schluss auf, dass all diese spezifischen Teilautonomien dennoch
zumindest in dem Sinne durch generelle Kräfte bestimmt sind, als sie
auf praktisch identische Weise mit der Gemeindegrösse korrelieren. In allen Fällen nämlich
sind es die allerkleinsten Gemeinden (mit unter 100 Einwohnern) die am
seltensten eine Einengung ihres Handlungsspielraums beklagen. Überall
nehmen die Autonomieverluste mit wachsender Bevölkerungszahl an Häufigkeit
zu, um bei Gemeinden zwischen 2'000 und 5'000 Einwohnern (in der Fürsorge:
bei 5 bis 10'000 Einw.) ihr Maximum zu erreichen. In allen Fällen
erfolgt danach wieder ein Abfall der Kurve, der die Kleinstädte in
die Nähe der kleinsten Landgemeinden bringt; und danach erfolgt überall
wieder ein scharfer Anstieg, in dem sich die besondere Autonomiebedrohung
der grösseren Städte (über 25'000 Einwohner) widerspiegelt. Dementsprechend erstaunt es
auch nicht, dass die Einschätzung der generellen Gemeindeautonomie
- mit der die Informanten die Entwicklung der verschiedenen Teilautonomien
in eine Synthese bringen - praktisch demselben Kurvenverlaufe folgt [2].
Tabelle 4: Prozentsatz der Gemeinden, deren Autonomie zwischen 1984 und 1994 in fünf verschiedenen Vollzugsbereichen abgenommen hat: nach Gemeindezahl des Kantons Anzahl Gemeinden im Kanton
Unabhängig von ihrer Einwohnerzahl sind die Gemeinden kleinerer Kantone am wenigsten von Autonomieeinbussen bedroht. Tabelle 4 zeigt, dass deren Häufigkeit insbesondere im Schul-, Fürsorge- und Finanzwesen bei Kantonen mit weniger als 60 Gemeinden weitaus am niedrigsten liegt, während im Planungssektor nur geringe und im Baubereich überhaupt keine Unterschiede festzustellen sind. Im Gegensatz zum generellen Autonomieverlust, der mit der Gemeindezahl des Kantons linear anwächst (vgl. Tab. 3), scheinen diese spezifischeren Einbussen an Selbständigkeit durchwegs eher bei den mittleren als bei den grössten Kantonen ihr Maximum zu erreichen. Schliesslich stellt sich die Frage, inwiefern sich beim generellen Autonomieverlust festgestellte Einfluss des ökonomischen Wohlstandsniveaus auch in den spezifischeren Vollzugsfeldern wiederfindet. Aus den Figuren 8, 9 und 10 lässt sich deutlich erkennen, dass zumindest Gemeinden mit mehr als 500 Einwohnern, in Kantonen jeder Grösse, sowohl im Bauwesen wie im Umweltschutz und der Fürsorge seltener Einbussen an Autonomie erlitten haben, wenn sie über eine besonders steuerkräftige Bevölkerung verfügen. Einzig beim Umweltschutz besteht bei grossen Gemeinden (über 5'000 Einw.), die in mittelgrossen Kantonen beheimatet sind, eine inverse Korrelation. Bei den kleinsten Gemeinden scheint sich der autonomiefördernde Einfluss einer hohen Finanzkraft auf den baulichen Sektor zu beschränken, während es im Umweltschutz- und Sozialwesen eher die reicheren Gemeinden sind, die häufiger Einbussen ihrer Handlungsfreiheit vermelden. Darüber hinaus wird aus den drei Figuren deutlich, dass die oben beschriebenen Wirkungen der Gemeinde- und Kantonsgrösse als sehr komplex und teilweise widersprüchlich veranschlagt werden müssen. So gilt beispielsweise für das Bauwesen, dass ärmere Kommunen in den kleinsten und reiche Gemeinden in den mittelgrossen Kantonen am häufigsten Autonomieeinbussen erlitten, während die reicheren Gemeinden im Fürsorgewesen weitaus am besten gefahren sind, wenn sie sich in einem kleinen Kanton befinden. Figur 8: Abnahme der Gemeindeautonomie im Baubewilligungswesen: nach Grösse und Wohlstandsniveau der Gemeinde und nach Gemeindezahl des Kantons Figur 9: Abnahme der Gemeindeautonomie im Umweltschutz und in der Entsorgung: nach Grösse und Wohlstandsniveau der Gemeinde und nach Gemeindezahl des Kantons Figur 10: Abnahme der Gemeindeautonomie im Sozial- und Fürsorgewesen: nach Grösse und Wohlstandsniveau der Gemeinde und nach Gemeindezahl des Kantons
6. Auswirkungen der Aufgabenverlagerungen auf die kommunalen Autonomie Aufgrund verschiedener Überlegungen könnte man vermuten, dass sich gleichsinnig mit der Expansion ihrer Tätigkeiten auch die Autonomie der Gemeinden (gegenüber der kantonalen Ebene) erhöht. Bringt nicht jede neue Aufgabe eine weitere Chance mit sich, wenigstens auf dem Niveau operativer Vollzugstätigkeit eigenständige Organisationsformen und Verfahrensweisen auszubilden und in Bereichen, die das Gesetz offen lässt, autonome Ermessensentscheide zu fällen? Und gibt es nicht sogar Aufgaben, wo - wie z.B. im Falle von Planungspflichten - die Gemeinden zu "echt politischen" Entscheidungen aufgefordert werden? Ist es nicht so, dass sich die kommunalen Organe im Zuge solcher Vollzugstätigkeiten allerhand wertvolle Kenntnisse und Erfahrungen erwerben, die es ihnen ermöglichen, Expertenmacht auszuüben und z.B. bei anstehenden Gesetzesrevisionen ein wichtiges Wort mitzusprechen? Und wenn es zutrifft, dass der Kanton immer mehr von den Leistungen seiner Gemeinden abhängig wird - ist dann nicht damit zu rechnen, dass diese immer besser in der Lage sind, selbstbewusst aufzutreten und sich für ihre Unentbehrlichkeit mit zusätzlichen Autonomiechancen honorieren zu lassen? Auf solche Argumentationen ist vor allem zu antworten, dass
Im Lichte dieser Gegenargumente wäre es nicht erstaunlich, wenn die zunehmende Aufgabenverlagerung auf die kommunale Ebene eher mit einem Verlust an Gemeindeautonomie einhergehen würde, und wenn ausgerechnet die Autonomie jener grösseren Gemeinden, denen besonders häufig zusätzliche Vollzugspflichten übertragen werden, innerhalb der letzten Jahre überdurchschnittlich starke Autonomieverluste erfahren hätten. Die Ergebnisse in Figur 11 legen den Schluss nahe, dass die Auswirkungen von Aufgabenverlagerungen auf die Gemeindeautonomie je nach Vollzugsbereich sehr unterschiedlich sind. Am engsten sind die Zusammenhänge offensichtlich im Bauwesen, wo eine Aufgabenreduktion in 80% der Fälle einen Autonomieverlust bewirkt hat und ein Aufgabenzuwachs in über 40% aller Fälle von einem Zuwachs an Handlungsspielräumen begleitet war. In den drei übrigen Vollzugsfeldern gehen die Zusammenhänge tendenziell in dieselbe Richtung, sind aber viel weniger ausgeprägt. Auf der einen Seite scheint es nur wenigen Gemeinden zu gelingen, zusätzliche Pflichtaufgaben für die Erweiterung ihrer kommunalen Autonomie zu nutzen; und auf der anderen Seite sind zahlreiche von ihnen in der Lage, einen Aufgabenverlust ohne Einbusse an Autonomie zu überstehen. Sowohl im Fürsorgewesen wie beim Umweltschutz und Finanzwesen sind es erstaunlicherweise die Gemeinden mit unverändertem Pflichtenheft, die weitaus am häufigsten ihre angestammte Autonomie beibehalten haben. Mit anderen Worten: der Autonomieverlust scheint in diesen drei Bereichen unabhängig davon einzutreten, in welche Richtung sich die Aufgabenverschiebung vollzieht. Ganz offensichtlich geht also auch ein Zuwachs an Leistungsanforderungen hier für die grosse Mehrheit der Gemeinden mit zunehmenden Einbindungen und Verflechtungen einher, die als Verlust an angestammter kommunaler Autonomie empfunden werden. Figur 11: Aufgabenverlagerungen und Veränderungen der kommunalen Autonomie in den jeweils selben Vollzugsbereichen
7. Auswirkungen der Aufgabenverlagerungen auf die binnenkommunale Politisierung Der Begriff "Vollzugsföderalismus" suggeriert, dass es sich bei den der Gemeinde übertragenen Aufgaben um rein administrative, regelprogrammierte Tätigkeiten handelt, die keinen Spielraum für echt politische Entscheidungen beinhalten und dementsprechend auch innerhalb der Gemeinde keinen Anlass für zusätzliche politische Diskussionen bieten. Diese Annahme ist mit Sicherheit falsch, wenn diese neuen Pflichten die Aufforderung an die Gemeinde beinhaltend, in einem bestimmten zusätzlichen Bereich regelbildend, ordnend oder steuernd tätig zu werden oder gar völlig selbständige Wege zur Problemlösung zu beschreiten. Dies gilt beispielsweise für das Planungsrecht, wo die Kommunen zur Produktion echt politischer Entscheidungen (z.B. über die Zonenzuordnung ihres Gebietes verpflichtet werden, oder für den Drogenbereich, wo ihnen vielerlei alternative Möglichkeiten der Betreuung, Unterstützung, Einweisung usw. offenstehen. Vor allem dort, wo vom Kanton oder Bund her nicht der Vollzug vorgegebener Regeln und Verfahren, sondern die Realisierung von Zielen verordnet wird, werden die Gemeinden häufig einen Schub "induzierter Politisierung" erfahren und genötigt sein, ihre Fähigkeiten zur öffentlichen Diskussion, friedlichen Konfliktaustragung und demokratischen Entscheidungsfindung auf eine neuartige Belastungsprobe zu stellen. Wenn es eine solch exogene, durch wachsende "vertikale Verflechtung" verursachte Politisierung gibt, müsste sich dies darin zeigen, dass Gemeinden, die in einem bestimmten Vollzugsbereich zusätzliche Aufgaben zugewiesen erhalten, in diesem selben Bereich häufiger eine Verschärfung politischer Auseinandersetzungen erfahren. Wie in den Figuren 12, 13 und 14 sichtbar wird, ist genau dies sowohl im Bauwesen wie im Umweltschutz und Fürsorgewesen sehr ausgeprägt der Fall. Beeindruckend an den Ergebnissen ist vor allem, wie konsistent sich diese Wirkung auf Gemeinden aller Grössenklassen erstreckt. Besonders deutlich zeigt sie sich einerseits bei den kleinsten Gemeinden und andererseits bei den Städten, während in mittelgrossen Kommunen (insbesondere zwischen 5'000 und 10'000 Einwohnern) offensichtlich eher endogene Quellen der Politisierung überwiegen. Obwohl die Richtung der Kausalität nicht zwingend aus den Kovarianzen hervorgeht, liegt immerhin die Schlussfolgerung nahe, dass Gemeinden bei der Übernahme mancher zusätzlicher Aufgaben keineswegs nur ein Anwachsen ihres administrativen Apparates, sondern auch eine Belebung ihrer politischen Diskussion und eine Mehrbelastung ihrer politischen Beratungs- und Entscheidungsstrukturen erfahren. Möglicherweise liegt darin ein Hauptgrund, warum derart zahlreiche Gemeinden eine zunehmende Sitzungsaktivität ihrer Exekutivbehörde vermelden. Figur 12: "Politische Auseinandersetzungen im Bauwesen sind härter geworden": nach Aufgabenverlagerung vom Kanton auf die Gemeinde und Gemeindegrösse
Figur 13: "Politische Auseinandersetzungen im Umweltschutz sind härter geworden": nach Aufgabenverlagerung vom Kanton auf die Gemeinde und Gemeindegrösse
Figur 14: "Politische Auseinandersetzungen im Fürsorgewesen sind härter geworden": nach Aufgabenverlagerung vom Kanton auf die Gemeinde und Gemeindegrösse
8. Schlussfolgerungen Die methodische Eigenheit der Untersuchung, dass der Zustand und Wandel der Gemeinden ausschliesslich aus der subjektiven Wahrnehmungsperspektive der Gemeindeschreiber erfasst wird, mag im vorliegenden Kapitel, wo nach dem Verhältnis zwischen Gemeinde und Kanton gefragt wird, besonders weitreichende Folgen haben. Insbesondere ist die pauschale Frage nach dem Grad der Gemeindeautonomie (und deren Wandel) wohl geeignet, ideologisch und emotional geprägte Einstellungen und Beurteilungen zu evozieren, die mit der objektiven Realität vielleicht nur in einem lockeren Verhältnis stehen. Diese Problematik wird dadurch verschärft, dass die Informanten angesichts der heutigen Komplexität administrativer und politischer Verhältnisse genötigt sind, eine Vielzahl unübersichtlicher und vielleicht widersprüchlicher Tatbestände und Entwicklungstrends zu einem umfassenden Gesamturteil zu integrieren. So muss insbesondere die Skaleneinstufung der Gemeinde auf der allgemeinen Autonomieskala mit Vorsicht bewertet werden, weil hier am meisten damit gerechnet werden muss, dass verschiedene Informanten die Realität an unterschiedlichen Referenzmassstäben messen und die verschiedenen Vollzugsbereiche (Finanzen, Fürsorge, Bauwesen etc.) in ihrer Gesamtbeurteilung unterschiedlich gewichten. Immerhin spricht es für die Validität der Auskünfte, dass die Befragten in der überwiegenden Mehrheit eine mittelmässig bis geringe Autonomie perzipieren, und dass die Unterschiede zwischen den Kantonen (insb. zwischen der deutschen Schweiz und der Westschweiz) weitgehend mit bereits bestehenden Kenntnissen koinzidieren. Das vielleicht wichtigste Ergebnis besteht darin, dass die befragten Schreiber in ihrer Mehrzahl für die Periode 1984 bis 1994 gleichzeitig
Dies koinzidiert völlig mit der in anderen westlichen Ländern beobachtbaren Entwicklung, dass Gemeinden im Zuge expandierender Staatstätigkeit einerseits zunehmend als Träger öffentlicher Leistungen in Anspruch genommen werden, andererseits aber in immer dichtere Felder überlokaler Regulierung und Steuerung eingebettet werden. Gleichzeitig bestätigen sich aber auch die differenzierenden Hypothesen der "Politikverflechtungstheorie", die besagen, dass die Gemeinden als Folge dieser eben genannten Doppelentwicklung keineswegs nur eine Einengung angestammter Handlungsspielräume, sondern auch eine gewisse Expansion neuer Spielräume erfahren. Dies wird darin sichtbar, dass Gemeinden, denen der Kanton zusätzliche Aufgaben übertragen hat, im entsprechenden Vollzugssektor häufiger als "Status quo-Gemeinden"
Erwartungsgemäss werden derartige
Entwicklungen auch durch Eigenheiten der Gemeinde einerseits und ihres
politischen Umfelds andererseits mitbeeinflusst. So zeigt sich, dass wohlhabendere
und in kleineren Kantonen beheimatete Gemeinden besonders gut in der Lage
gewesen sind, ihren angestammten Autonomiespielraum beizubehalten oder
gar zu expandieren. Andererseits aber waren überraschenderweise
keineswegs die kleinen Gemeinden, sondern die grösseren Städte
am häufigsten von einem Autonomieverlust betroffen. Hierin widerspiegelt sich die
Tatsache, dass Städte aufgrund ihrer zentralörtlichen Funktionen
besonders dicht in überlokale Vollzugsstrukturen eingebettet sind
und infolge ihrer hohen Heterogenität (und demzufolge geringen Artikulationsfähigkeit)
zunehmend Mühe haben, im externen politischen Raum einen ihrem quantitativen
Gewicht entsprechenden Einfluss geltend zu machen (vgl. Kap. 1).
Anmerkungen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
|
aktualisiert am 25.08.2014
.gif)