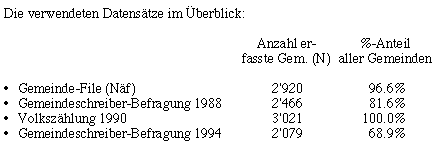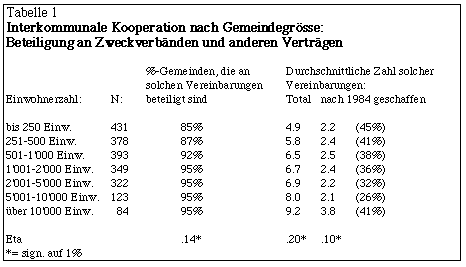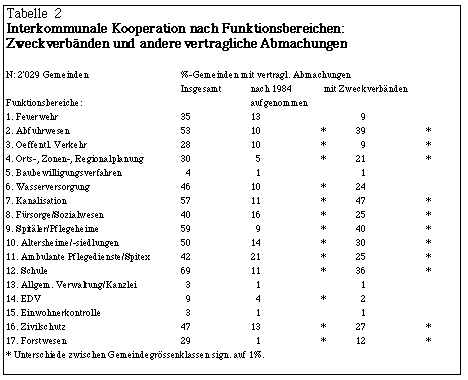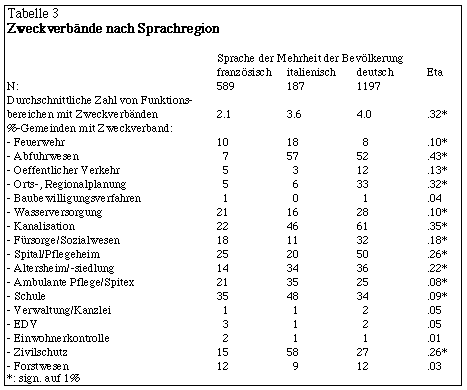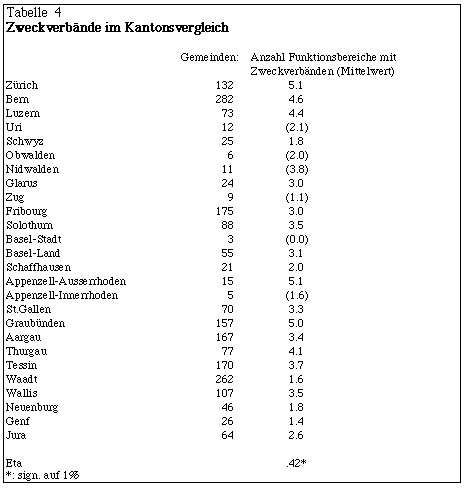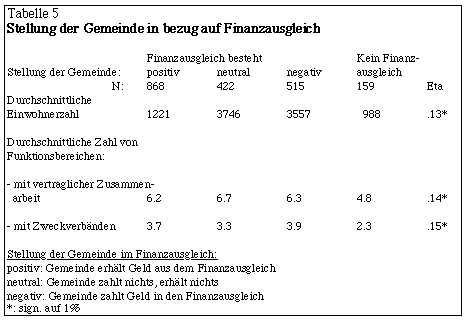|
|||||
|
Kooperation mit anderen Gemeinden und mit Privaten Ein Beitrag im Rahmen des Nationalfondsprojektes
"Aktuelle Wandlungstendenzen und Leistungsgrenzen von François Höpflinger
Inhalt In diesem Beitrag werden zwei bedeutsame Formen 'grenzüberschreitender Zusammenarbeit' vorgestellt und diskutiert: Zum ersten wird die Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden in Form von Zweckverbänden oder anderen vertraglichen Vereinbarungen analysiert. Zum zweiten wird die Kooperation mit privaten Experten und Firmen untersucht. In beiden Fällen handelt es sich um Kooperationsformen, die in den letzten Jahrzehnten an Bedeutung gewonnen haben und die auch in Zukunft zentral sein werden.Inhaltsverzeichnis Methodische Hinweise1. Kooperationen mit anderen Gemeinden (Zweckverbände usw.) 2. Zusammenarbeit mit
privaten Büros und Experten
Methodische Hinweise Die vorliegende Studie basiert auf einer im Jahre 1994 am Soziologischen Institut der Universität Zürich durchgeführten schriftlichen Befragung. Finanziert wurde sie vom Schweizerischen Nationalfonds. Die Untersuchung richtete sich an die Gemeindeschreiberinnen und Gemeindeschreiber sämtlicher 3'017 Schweizer Gemeinden (Stand 1. Jan. 1994). Insgesamt haben 2'079 Gemeinden an der Befragung teilgenommen und die Beteiligung ist mit einem Rücklauf von knapp 70 Prozent ausgesprochen hoch ausgefallen.Das Projekt wurde im Oktober 1993 mit ersten Vorarbeiten gestartet und endete im Laufe des Februars 1996 mit der Abgabe des Schlussberichtes an den Schweizerischen Nationalfonds (Nr. 12-32586.92). Am Projekt mitgearbeitet haben Prof. Hans Geser als Projektleiter, Robert Fluder, François Höpflinger, Andreas Ladner und Urs Meuli. Die für die vorliegenden Arbeiten verwendeten Daten stammen nicht nur aus der Befragung von 1994. Als Ergänzung sind noch andere Zahlen in die Analyse einbezogen worden, so jene des Soziologen Rolf Nef, der für seine Analysen über kommunales Wahlverhalten Datensätze demographischer, ökologischer und sozioökonomischer Art für sämtliche Gemeinden der Schweiz zusammengetragen hat. Dabei handelt es sich vor allem um Volkszählungsdaten, Betriebszählungsdaten und Wehrsteuerstatistiken. Ausserdem konnten wir auch auf Daten eines eigenen Forschungsprojektes zurückgreifen, die 1988 durch eine erste Befragung der Gemeindeschreiber und Gemeindeschreiberinnen sämtlicher Gemeinden der Schweiz erhoben wurden. Diese Befragung erzielte einen Rücklauf von über 80 Prozent, so dass sie uns für die Analyse des Wandels der politisch-administrativen und der kommunalpolitischen Organisation der Gemeinden im allgemeinen und des kommunalen Parteiwesens im besonderen sehr aussagekräftige Resultate lieferte.
1 Kooperationen mit anderen Gemeinden (Zweckverbände usw.) Es gibt - vor allem für kleine Gemeinden - eine Reihe von Gründen, weshalb eine Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden bzw. sogar ein Zusammenschluss mit Nachbargemeinden sinnvoll sein kann:
Die überwiegende Mehrheit aller Schweizer Gemeinden hat heute via vertraglicher Abmachungen (Zweckverbände, Zusammenarbeitsverträge, Anschlussverträge u.ä.) eine regelmässige Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden verankert. Nur 8% aller befragten Gemeinden sind ohne institutionelle Kooperation. Am häufigsten ist dies bei Kleingemeinden der Fall. Die Zahl der Vereinbarungen variiert sachgemäss mit der Grösse einer Gemeinde, aber auch Kleingemeinden sind durchschnittlich heute an gut 5 interkommunalen Vereinbarungen beteiligt. Ein beträchtlicher Teil dieser Vereinbarungen sind allerdings erst in den letzten zehn Jahren eingeführt worden. Die zunehmende wirtschaftliche und ökologische Verflechtung kommunaler Auf gaben hat zu einer verstärkten Ausbreitung interkommunaler Zusammenarbeit geführt, wodurch das ursprüngliche föderalistische Prinzip durch eine wesentliche neue Komponente ergänzt wurde. Jedenfalls ist der Trend zu einem kooperativem Föderalismus unverkennbar.
Allerdings ist die interkommunale Kooperation stark funktionsspezifisch geprägt. Die funktionsspezifische Gestaltung interkommunaler Kooperation wird darin sichtbar, dass die Interkorrelationen zwischen dem Vorhandensein von Zweckverbänden und/oder anderen vertraglichen Abmachungen bei verschiedenen Funktionsbereichen sehr gering sind. Es gibt dazu nur zwei Ausnahmen:
Zweckverbände und vertragliche Abmachungen mit
anderen Gemeinden sind einerseits bei ökologisch relevanten Bereichen,
wie Abfuhrwesen, Wasserversorgung, Kanalisation u.a., recht häufig
(und sie weisen oft eine langjährige Tradition auf). In diesen Bereichen
überschreiten die entsprechenden Aufgaben sachgemäss häufig
die traditionellen Gemeindegrenzen, und in diesem Sinne widerspiegelt die
interkommunale Zusammenarbeit die starke (und zunehmende) ökologische
Verflechtung moderner Gesellschaften. In diesen Bereichen sind die grössenbedingten
Unterschiede weniger ausgeprägt bzw. insignifikant, da die wechselseitige
räumliche Verflechtung verschiedener Gemeinden und weniger die Gemeindegrösse
an sich die entscheidende Variable darstellt.
Die Untersuchung der Frage, welche strukturellen
Faktoren (Reichtum, demographische Struktur, Modernität) einer Gemeinde
die Häufigkeit interkommunaler Kooperationen erhöhen, ist vor
allem in negativer Hinsicht bemerkenswert: Die kommunalen Strukturdimensionen
bestimmen die generelle Häufigkeit vertraglicher interkommunaler Zusammenarbeit
kaum. Darin widerspiegelt sich einerseits die vorher angeführte funktionsspezifische
Gestaltung interkommunaler Zusammenarbeit (womit für jeden Funktionsbereich
andere Strukturfaktoren bedeutsam sind und sich momentan noch kaum eine
Generalisierung interkommunaler Zusammenarbeit ergibt). Andererseits steht
zu erwarten, dass eine interkommunale Kooperation definitionsgemäss
nicht allein von den strukturellen Gegebenheiten der Einzelgemeinden geprägt
wird. So setzt eine interkommunale Zusammenarbeit gleichgesinnte und eventuell
auch strukturell ähnlich gelagerte Nachbargemeinden voraus.
Neben räumlich-strukturellen Aspekten (Agglomerisierung
u.a.) dürfte die (institutionalisierte) Kooperation zwischen Gemeinden
allerdings auch von den übergeordneten Instanzen (Kanton, Bund) beeinflusst
werden.
Diese Vermutung wird durch die ausgeprägten Unterschiede zwischen den Sprachregionen unterstützt.
So sind Zweckverbände in der französischsprachigen
Schweiz deutlich weniger häufig als in der deutschsprachigen Schweiz.
Dies hat weniger mit einer stärkeren Betonung der Gemeindeautonomie
in der Westschweiz zu tun, als mit der Tatsache, dass in den meisten Westschweizer
Kantonen der Kanton eine stärkere Rolle spielt als in vielen Kantonen
der Deutschschweiz. Durch die oft enge und direkte Kooperation von Gemeinden
und Kanton bzw. die Kantonalisierung verschiedener staatlicher Funktionen
verliert die mittlere, regionale Ebene an Bedeutung.
Hinter den allgemeinen regionalen Unterschieden verbergen
sich sachgemäss massive kantonale Differenzen, und zwar sowohl in
der Deutschschweiz als auch in der Westschweiz.
Neben kantonalen Traditionen in der Betonung der
Gemeindeautonomie dürfte - wie erwähnt - auch die Aufgabenverteilung
zwischen Kanton und Gemeinden die Bereitschaft zu interkommunalen Vereinbarungen
bzw. Zweckverbänden beeinflussen. Ein Hinweis in dieser Richtung zeigt
sich in einer deutlichen Korrelation (r=.51, N: 26 Kantone) zwischen der
durchschnittlichen Zahl von Funktionsbereichen mit Zweckverbänden
in den Kantonen und dem Anteil der Gemeinden an den Ausgaben von Kanton
und Gemeinden für 'Soziale Wohl fahrt' 1990. Je weniger der Kanton
direkt interveniert, desto eher wird Kooperation auf interkommunaler Ebene
gesucht, wogegen bei direkter Intervention des Kantons die interkommuale
Zusammenarbeit durch die direkte Beziehung Kanton-Gemeinde substituiert
wird.
Der oben angeführte Gemeindevergleich bestätigt
zumindest die erste Vermutung: Gemeinden in Kantonen ohne Finanzausgleich
kennen deutlich weniger Zweckverbände oder interkommunale Verträge
als Gemeinden in Kantonen mit Finanzausgleich, und dies obwohl diese Gemeinden
im Durchschnitt kleiner sind. Es scheint, dass ein Finanzausgleich interkommunale
Kooperation fördert. Allerdings kann auch argumentiert werden, dass
in Kantonen mit starker Betonung der Gemeindeautonomie sowohl ein Finanzausgleich
als auch eine interkommunale Zusammenarbeit auf starke Widerstände stossen.
Interkommunale Kooperation hat in den letzten Jahren
eindeutig an Bedeutung gewonnen. Demgemäss lässt sich ein klarer
Trend in Richtung eines verstärkten 'Kooperationsföderalismus'
festhalten. Die Zusammenarbeit zwischen Gemein den ist allerdings stark
funktionsspezifisch (und damit nur selten generalisiert). Von grosser Bedeutung
sind diesbezüglich regionale und kantonale Unterschiede in der Betonung
der Gemeindeautonomie und im Verhältnis von Kanton und Gemeinden.
2 Zusammenarbeit mit privaten Büros und Experten Während in den 1960er und 1970er Jahren eine ausgeprägte Trennung von Staat und Privatwirtschaft betont wurde, hat sich die Diskussion seit den 1980er Jahren verlagert. Zum einen wurde im Rahmen einer verstärkten 'Privatisierung' staatlicher Unternehmungen die Stellung des Staates ganz allgemein hinterfragt: Inwiefern können und sollen bisher staatlich organisierte Aufgaben nicht durch private Unternehmen bewältigt werden? Effizienzvorteile, aber auch eine verstärkte Konkurrenz bei privater Produktion von Gütern sind die häufigsten Argumente für eine Privatisierung staatlicher Aufgaben.Im Rahmen der Diskussion einer Privatisierung bisher staatlich erbrachter Güter und Dienstleistungen erhalten auch neue Formen einer Zusammenarbeit öffentlicher und privater Stellen und Organisationen eine verstärkte Aktualität. Die Inanspruchnahme privater Stellen kann einerseits zur Entlastung der öffentlichen Verwaltung dienen. Sie kann aber auch die Professionalität öffentlicher Aufgabenerfüllung erhöhen, etwa wenn bei komplexen Sachfragen auf private Expertise zurückgegriffen wird. Öffentliche Aufgaben können somit aus verschiedenen Gründen an private Büros und Experten übergeben werden:
Im Rahmen der Gemeindestudie bezog sich nur eine Frage explizit auf die Inanspruchnahme privater Büros und Experten: "Nimmt ihre Gemeinde in be stimmten Bereichen regelmässig Leistungen von privaten Büros und Experten in Anspruch?" Tabelle 6 zeigt, in welchen Funktionsbereichen private Expertise und Leistungen am ehesten beansprucht werden, und wie sich die Inanspruchnahme privater Büros und Experten seit 1984 verändert hat:
Eine regelmässige Beanspruchung privater Büros
und Experten ist vor allem in jenen Bereichen häufig, wo es um komplexe
Sachfragen geht, deren Erfüllung im allgemeinen eine hohe Professionalität
und Spezialisierung voraussetzt (z.B. Baufragen, Zonenplanung). Dies kommt
auch darin zum Ausdruck, dass Ge meinden, die bei Baufragen oder Zonenplanungen
private Büros in Anspruch nehmen, dazu tendieren, private Expertise
für EDV oder juristische Fragen zu mobilisieren.
Im Vergleich zur interkommunalen Kooperation zeigt die Inanspruchnahme privater Büros und Experten eine weniger ausgeprägte funktionsspezifische Differenzierung. Gemeinden, die in einem Funktionsbereich auf private Expertise zurückgreifen, tendieren auch in anderen Bereichen zur Privatisierung und Externalisierung von Aufgaben. Besonders deutlich sind die Interkorrelationen in zwei Bereichen: Umweltschutz, Naturschutz und Entsorgung einerseits, und Bauwesen, Zonenplanung, Verkehrsplanung, Ortsbildschutz andererseits. Es handelt sich um kommunale Aufgaben, die zum einen eine besonders hohe Professionalität verlangen. Zum anderen sind es Aufgaben, die - weil sie private Interessen tangieren - politisch besonderer Legitimation bedürfen. In diesem Sinne ist die Inanspruchnahme privater Büros und Experten ein zentrales Element im 'Interface' privater und öffentlicher Interessen. Entsprechend ist der Wunsch nach einer verstärkten Inanspruchnahme privater Experten bei Gemeinden, die sich mit neuen, politisch heiklen Betreuungsaufgaben (etwa Betreuung von Drogenabhängigen und älterer Personen) konfrontiert sehen, besonders ausgeprägt. Da die Leistungen privater Büros und Experten primär dem Zweck dienen, 'Professionalität' zu erreichen, ergeben sich klare Beziehungen mit der Gemeindegrösse (vgl. Tabelle 7). Mit Ausnahme des Steuerwesens ist die regelmässige Beanspruchung privater Büros und Experten deutlich mit der Einwohnerzahl assoziiert, und es sind primär mittelgrosse bis grosse Gemeinden, die regelmässig die Leistungen privater Büros und Experten beanspruchen. Mit zunehmender Einwohnerzahl nimmt die Komplexität der Sachfragen teilweise stärker zu, als die Fähigkeit der Gemeinde, die entsprechende Expertise - via Ausdifferenzierung von Fachstellen - direkt zu internalisieren. Bei kleinen Gemeinden erfolgt der Einkauf privater Expertise unregelmässig, und zudem fliesst in diesen Gemeinden private Expertise primär via Milizsystem ein. [1]
Zusätzlich zur Gemeindegrösse zeigen sich
bedeutsame regionale Differenzen, und zwar in dem Sinn, dass französischsprachige
Gemeinden weniger private Expertise in Anspruch nehmen. Dies betrifft hauptsächlich
kleinere Westschweizer Gemeinden mit weniger als 2'000 Einwohner. Solche
regionale Unter schiede können sozio-kulturelle Unterschiede in der
politischen Legitimation des öffentlichen Sektors widerspiegeln. Zudem
ist die öffentliche Verwaltung in Westschweizer Gemeinden vielfach
stärker ausgebaut, was die Nachfrage nach externen, privaten Leistungen
reduziert.
Auch die These einer substitutiven Beziehung zwischen öffentlicher und privater Aufgabenerfüllung (Einsatz privater Büros und Experten um die Gemeindeverwaltung klein zu halten und dennoch komplexe Fachaufgaben zu erfüllen), findet nur auf einen ersten Blick eine empirische Unterstützung. Es zeigt sich zwar insgesamt eine signifikant negative Korrelation (r = -.14, sign. auf 1%) zwischen dem Ausbau der Kernverwaltung (administratives Personal pro 100 Einwohner) und der Zahl von kommunalen Funktionsbereichen, in denen regelmässig auf private Büros und Experten zurückgegriffen wird, aber nach statistischer Kontrolle der Gemeindegrösse verschwindet diese Beziehung. Insgesamt gesehen werden private Büros und Experten
von den Gemeinden heute primär zum Zweck erhöhter Professionalität
bei komplexen Fragen, die private und gut organisierte Interessen tangieren,
benützt. Hingegen stehen Aspekte der Effizienzsteigerung oder einer
Verlagerung von Aufgaben in den privaten Sektor - z.B. zur Reduktion der
öffentlichen Verwaltung - (noch) weniger im Zentrum. Ein substitutives
Verhältnis privater und öffentlicher Auf gabenerfüllung
lässt sich auf kommunaler Ebene jedenfalls momentan kaum feststellen.
|
|||||
|
![]()
aktualisiert am 21.10.2011